Restore Factory Defaults– Alienate the Alienation
(Andreas Eduardo Frank)
Die Vorarbeiten zu Restore Factory Defaults begannen im Frühjahr 2016, als Anne-May Krüger auf mich zukam und mir vom aktuellen Stand ihrer Forschungsarbeit erzählte. Sie beauftragte mich als Komponisten mit einem neuen Werk, welches sich auf die Fabbrica beziehen sollte. Der erste Teil ihrer praktischen Arbeit sah die Interpretation von Nonos La fabbrica illuminata vor, der zweite die Herstellung eines teilweise neuen Zuspielbands für Nonos Fabbrica – natürlich mit Krügers Stimme anstelle der von Carla Henius. Dann sollte eine Neukomposition, die sich auf Nonos Fabbrica illuminata bezog, den dritten und letzten Teil bilden. Dieser Punkt war nun derjenige, an dem ich als Komponist meinen Beitrag leisten sollte.
Mich mit Meilensteinen der Musikgeschichte zu befassen, ist und war mir immer wichtig, sich jedoch auf das Komponieren mit so klaren Bezügen einzulassen, fühlte sich zunächst beengend an. Es war klar: Ich musste eine Situation schaffen, in der ich die maximale gestalterische Freiheit über meine Komposition behalten konnte, um Integrität und Authentizität meiner Musik in Gegenüberstellung zu Nonos Fabbrica zu gewährleisten. Denn eine Voraussetzung für das neue Stück war der klare inhaltliche und musikalische Bezug zur Fabbrica, und eine weitere der Prozess der kollaborativen Materialentwicklung. Also jener Prozess, der bei Nono und Henius stattfand, als sie an der Fabbrica arbeiteten.
Da es sich bei Fabbrica um ein Solowerk mit elektroakustischer Erweiterung handelt, betrachtete ich zunächst das Verhältnis zwischen dem elektronischen Part der Komposition, also dem quadrophonen Zuspiel, und dem Part der Sängerin. Die Vokalklänge auf dem Tape stammen zu großen Teilen von Nonos Studioaufnahmen mit Henius, die während des Entstehungsprozesses des Stückes stattfanden. Die Korrelation von Henius’ Stimme im Tape und ihrer realen Stimme ist nur dann gewährleistet, wenn Carla Henius selbst singt. Durch die Interpretation anderer hingegen ändert sich eine komplette ästhetische und semantische Dimension. Dieser Situation wollte ich vorbeugen, und somit war eine der grundlegenden Ideen für mein neues Stück, die medialen Komponenten der Factory für nachfolgende Interpretinnen und Interpreten unter gleichen Bedingungen ausführbar zu halten.
Ich tauchte weiter in Nonos Pionierwerk ein. Der erste Klangeindruck ist beeindruckend. Immer wieder fällt mir auf, wie stark das Tonband mit der Stimme von Henius verschmilzt und die Gesangspartie den elektronischen Klängen eine virtuelle Körperlichkeit verleiht. Das Nebeneinander sowie auch die Überlagerungen von Henius auf dem Tonband mit der Live-Partie zusammen mit den schroffen und elektronisch verfremdeten Fabrikklängen aus den Italsider-Stahlwerken kreieren eine dystopisch-theatrale Klangwelt, in der die Sängerin als virtueller Avatar im Tonband und als realer Mensch auf der Bühne beide Hauptrollen teilt. Nono schafft eine reichhaltige und packende Klangkulisse, arbeitet mit einer breiten Palette an Farben, mischt konkrete und unkonkrete Klänge kontrastreich im Tonband, setzt aber dennoch auf das emotionale Moment in der Gesangspartie. Dies wird beim Lesen des zugrundeliegenden Textes von Nonos Librettisten Giuliano Scabia umso verständlicher. Nono nutzt den Text, um sein Statement zu den realpolitischen Themen der damaligen Zeit abzugeben. Er drückt in der Fabbrica explizit seinen Standpunkt aus und bezieht sich durch den Text auf die prekären Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung, die Entfremdung der Arbeiterklasse der Italsider-Stahlwerke in Genua in den 1960er Jahren.
Die Gesangspartie ist im Vergleich zu den schroffen, entrückten Fabrikklängen und Arbeiterchören vergleichsweise traditionell gesetzt. Das Zuspiel illustriert geradezu die raue Umgebung der Arbeiter, wohingegen die Gesangspartie einen lyrisch emotionalen Gegenpol kreiert, Mittler seiner politisch motivierten Komposition ist und ihr schlussendlich Wirksamkeit verleihen möchte. Nonos ästhetische Vision von einem polarisierenden und aufrüttelnden „Musiktheater“ bleibt innerhalb der beschriebenen klanglichen Kategorien gefangen: ein intrinsischer Kampf zwischen musikalisch-emotionaler Treibkraft und klanglicher Entfremdung, der nicht weit genug geht, um sich aus dem selbstinduzierten Romantisieren zu befreien. Nonos klangliche Motivationen gehen in eine klare Richtung, seine eigenen Äußerungen zum Nachkriegskapitalismus sind stets kritischer Natur. In diesem Werk fehlt mir persönlich die nötige Radikalität, um den Entfremdungsprozess ästhetisch konsequent nachzuempfinden.
Es war an der Zeit, einen Anknüpfungspunkt an Nonos Fabbrica herzustellen. Der erste konkrete Ansatz war, sich auf musikalische und Konstruktionsparameter zu beziehen, eine Art Zeit- und Formnetz von Nonos Komposition abzuleiten und mit seinen Proportionen zu arbeiten, sodass seine Komposition wie ein Palimpsest durch die meine hindurchschimmern würde. Dies erschien naheliegend, jedoch wenig originell, da oft praktiziert.
Zwischen der ersten Beschäftigung mit Nonos Werk und der konkreten Situation des konzentrierten Komponierens verging etwa ein Jahr. Als ich in den finalen Konzeptions- und Kompositionsprozess eintauchte, verwarf ich die anfänglichen Gedanken. Es erschien witzlos, mich auf musikalische Parameter zu beziehen und eine Musik über die Musik zu schreiben, die mit Zitaten oder der Übernahme von Konstruktionsparametern arbeitet. Das wäre zu einfach, zu naheliegend, die „gängige“ Variante. Auch der Kreidler’sche Ansatz einer Musik mit Musik kam für mich nicht infrage. Ich wollte meine eigene Lösung finden und an meine ästhetische Linie – den roten Faden, der sich durch meine Werke zieht – anknüpfen, eine „poetische Überidee“ implementieren, ein „Fantastikum“ erschaffen, eine Welt, die in sich inhaltlich und musikalisch kohärent ist und trotzdem einen Bezug zu Nonos Werk aufweist. Zudem erschien es mir wichtig, den emotionalen und performativen Spielraum in alle Richtungen offenzuhalten, denn obwohl Elemente wie Humor, Witz, Absurdität oder gar das „Doofe“ in Nonos Werk fehlen, spielen sie in meinen Stücken eine wichtige Rolle.
Um eine Brücke zu schlagen, die mir möglichst viel Spielraum lassen würde und doch einen der grundlegendsten Gedanken in Nonos Werk aufgriff, entschloss ich mich, die Idee von Arbeit und Ausbeutung aufzugreifen. Wenn man die Fabbrica inhaltlich auf die grundlegendsten Eckpfeiler eindampft, bleibt das Thema der Arbeit und der Entfremdung des Individuums übrig. Ich setzte mich mit Marx’ Konzept der entfremdeten Arbeit und verwandten geisteswissenschaftlichen Theorien zur Idee von „Arbeit“ auseinander. Es drängte sich die Frage auf, wie ich das Thema auf mein Werk, meine „Arbeit“, übertragen kann; wie verhält sich die Performance der Interpretin zum Thema, und was bedeutet Kunstschaffen allgemein in diesem Kontext?
Bei Nono steht für mich das Marx’sche Konzept der Entfremdung der Arbeiterklasse von ihrem Gattungswesen im Mittelpunkt. Ich wollte ebendiese Begrifflichkeit in meinem Werk neu kontextualisieren und mit dem Raum der Performance verknüpfen, sozusagen eine Vermischung des realen, des musikalischen und des inhaltlichen Raums angehen. Diese Idee war wegweisend für die restliche Komposition, und ich begann die inhaltlichen Schwerpunkte für mein Stück genauer zu definieren und mir abgeleitet davon die Form des Stückes zurechtzulegen. Anzumerken ist, dass als Relikt des ersten Gedankens, der Übernahme von Nonos Konstruktionsparametern, noch zeitliche Einteilungen übrig geblieben waren, an denen sich die Dauern der inhaltlichen Abschnitte des Stücks orientieren sollten.
In der ersten ausformulierten Anlage des Stücks gab es vier Abschnitte, von denen am Ende nur noch einer so übrig bleiben sollte, wie er im Abbild der unten stehenden Skizze (s. Abb. 3) zu sehen ist. Es kam noch ein weiterer zweiter Teil hinzu, der sich während der Arbeit am Libretto als Konsequenz aus dem ersten Abschnitt ergab. Dieser erste Abschnitt bezog sich inhaltlich direkt auf Marx’ Zitat (hier im Englischen): „the alienation of the worker from their Gattungswesen (species essence)“.

Ich verwandelte es in the alienation of the singer from their Gattungswesen. Mir gefiel, dass das Wort Gattungswesen sich bereits in der Übersetzung als Fremdwort etabliert hatte, und so kam es, dass ich dieses Changieren zwischen den Sprachen und das Festhalten an Fremdwörtern auch in meinem Stück benutzen wollte. Die vier oben abgebildeten Satzbezeichnungen deckten unterschiedliche Themenkomplexe ab und sollten in sich abgeschlossene Einheiten bilden, die zu einem großen Ganzen zusammenfallen.
Der erste Satz handelte von der Entfremdung der Sänger-(Klasse) von ihrem Gattungswesen. Eine Lecture-Performance mit dem Titel Fließende Bänder sollte zum zweiten Satz werden. Ich wollte das Singen an sich in einem analytischen Vortrag erörtern. Die Protagonistin würde dabei zwischen musikalischer Sprache und Performance hin und her wechseln, ein analytisch-spielerisches Dekonstruieren des Gesangsmoments. Es sollte eine virtuos-analytische Vortragssituation sein, in der die Grenzen zwischen dem, was die Sängerin inhaltlich umreißt, also dem konkret gesprochenen Text, und der musikalischen Performance-Situation verschmelzen. Beide Ebenen sollten sich gegenseitig kommentieren können, sodass eine fluktuierende Kohärenz zwischen dem, was gesagt, und dem, wie es gesagt bzw. gesungen wird, entstehen kann.
L’art est mort – vivre l’art war die Idee für den dritten Abschnitt. Ich wollte die etablierte analytische Klammer des zweiten Satzes um eine Ebene höher stellen, eine Metaebene kreieren und einen Diskurs über die Kunst eröffnen. Es sollte eine Reflexion werden über den Moment, über das selbstreferenzielle Element innerhalb unserer Kunst und über das immer wieder von vorne Anfangen („nochmal von vorn!“). Eine Suche nach musikalischem Material und Sinn, die sich selbst aus Iteration und Rekursion konstituiert.
Riproduzione del ultimo suono sollte der vierte und letzte Satz des Stücks werden, in dem es um die Reproduktion des allerletzten Klangs geht. Quasi eine musikalische Performance, in der die Reproduktion des vermeintlich Unreproduzierbaren zelebriert wird. Es sollte ein poetischer Abschluss ohne Abschluss werden, die Wiederholung des „allerletzten Klangs“ (oder auch des allerletzten musikalischen Gedankens), der durch die Wiederholung seine eigene Gültigkeit als das eigentlich Letzte verliert.
Dies war der Stand meiner Überlegungen, bevor es ans Komponieren ging, bevor sich die vorangehenden konzeptuellen und inhaltlichen Gedanken mit der musikalischen Realität trafen.
Es ist üblich, dass ich beim Kompositionsprozess etliches aussortiere, anpasse oder meine Meinung über inhaltliche Konzepte zugunsten musikalischer Ideen zurechtbiege. So war es auch im Fall der Factory. Blickt man nämlich auf die finale Fassung, gibt es nur noch zwei anstelle der geplanten vier Sätze:
- the alienation of the singer from their Gattungswesen
- how to exceed the speed of light
Sobald ich mich an die Ausarbeitung des Librettos und des Settings machte, uferten der erste Satz und sein inhaltlicher Themenschwerpunkt derart aus, dass dieses Material an sich bereits ausreichte, um ein in sich abgeschlossenes Stück zu schreiben. Dennoch gärten die oben beschriebenen Gedanken zu den Sätzen 2 bis 4 in mir weiter und fanden ihren Weg in das Stück. Sie wurden zum Beispiel zu Binnenabschnitten oder zu rekursiven und interaktiven Strukturen und Momenten, zu Text oder zu einzelnen musikalischen Motiven.
Die letztendlich für mich maßgebliche kompositorische Arbeit begann mit dem Festlegen des Settings und der Arbeit am Libretto. Mir war klar, dass der Text zwischen sprachlicher und musikalischer Ebene oszillieren musste, dass die Art und Weise des Vortrags das musikalische und formale Skelett bilden würde und dieses Skelett die anderen Ebenen des Werks über die Dauer tragen musste. Die Idee der Lecture brachte mich auf die Vortragsform des Stücks, die ich bei einer Session mit Anne-May im Vorfeld der Komposition erarbeitete. Ich brachte Textfragmente über die Erzeugung von Klang durch die menschliche Stimme mit, und wir gestalteten den Text ad hoc musikalisch aus und verbanden dies mit der Idee der Lecture als Vortragsform. Das gab dem Ganzen bereits eine grobe Richtung.
Da mir der Monolog als Vortragsform auf die Dauer zu beschränkt erschien, erschuf ich einen Gegenspieler, um den Entfremdungsprozess erlebbar zu machen. Daraus wuchs eine ganze Entfremdungsmaschinerie, ein konkretes Etwas, das sich als der Konterpart der Sängerin etabliert, sich ihre Fähigkeiten aneignet, sich als ihr Freund ausgibt, mit ihr in einen Dialog tritt und sie in einen Wettkampf verwickelt, den sie nur verlieren kann.
Mir war klar, dass ich die Videoebene als zusätzliche narrative Dimension nutzen wollte, deshalb legte ich Anne-Mays Gegenspieler innerhalb dieser Ebene an. Die Mittel waren also das großformatige, immersive Bild, Licht und Zuspiel. Ich stellte mir Anne-May zentral sitzend vor einer großen Projektionsleinwand vor, auf der ein Zusammenspiel aus Video, Licht und Sounds die Sängerin zunehmend am Singen hindert und schikaniert, auf der schließlich virtuelle Avatare von ihr selbst auftauchen, die mit ihr in einen Dialog treten. Mir war wichtig, dass sich ihre Umwelt verändert, dies wollte ich durch scharf begrenzte Licht- und Soundräume erreichen.
Die Taktiken, mit denen die Entfremdung vonstatten ging, sollten zunehmend intelligenter werden. So entwickelte sich das halbstatische Setting der Sängerin fortlaufend weiter. Sie sollte auf einem Drehhocker sitzen und es sollten hauptsächlich ihr Gesicht und ihre Hände zu sehen sein. Am Ende ergab sich eine Art museales Bild, in dem Anne-May wie eine plastische Büste aus dem dahinterliegenden zweidimensionalen Videobild herausragt und vor dem sie sich um ihre eigene Achse drehen kann. Die Videoleinwand sollte so bemessen sein, dass bereits die Größe im Vergleich zum Menschen eine gewisse Macht auszuüben vermochte. So wollte ich erreichen, dass das sich stetig wandelnde Setting ihr zwar einen Raum gibt, dieser aber fremdgesteuert wird, sie ihn nicht bestimmt, aber mit ihm interagiert. Das Setting selbst wurde zur Entfremdungsmaschine und ermöglichte mir, außerhalb der Performance-Ebene der Protagonistin etwas zu erzählen und das Geschehen zu kommentieren.
Beim Kompositionsprozess ging es Schritt für Schritt von den inhaltlichen Gedankenexperimenten über das Setting zum Libretto und weiter zur Entwicklung der Notation, die sich über die Handschrift bis zur Abschrift im Notationsprogramm entwickelte und letztlich zur Produktion des Videos sowie des Zuspielbands führte. Als ich begann, am definitiven Text für das Stück zu arbeiten, hatte ich eine Sammlung an ausgewählten Textstellen zusammengetragen, mit Texten von Marx, Scabia, wissenschaftlichen Kompendien und philosophischen Abhandlungen zu den Themen Entfremdung und Arbeit sowie zur Funktionalität der menschlichen Stimmorgane. Die Fülle an Material gab eine solide Grundlage, um frei daraus zu schöpfen und selbst einen reduzierten Text zu entwerfen, der minimalistisch sein sollte, das Wesentliche erzählen und Platz lassen sollte für das, was ich über die Ebenen des Settings, des Raums, der Projektionen, der Elektronik und des performativen Aspekts der Aufführung erzählen wollte. Dennoch musste ich, um diese Reduktion zu erreichen, bereits im Text alles mitdenken und ihn mit dem Gesamtgeschehen verbinden. Alles musste geplant sein. Auf inhaltlicher Ebene fand ich meinen Einstieg, indem ich die Performance-Situation in einen kommentierten Fluss brachte. Es war im Prinzip die Idee der Lecture-Performance, die hier den Einstieg bereitete und den Ablauf für den Anfang des Stückes vorgab. Es stellte sich die Frage, wie ich diese Ideen mit der visuellen Ebene der Entfremdungsmaschinerie verbinden würde.
Beim Schreiben des Textes wurden die Bilder innerhalb des Settings immer konkreter, ich wollte über stark begrenzte Lichtfelder den sichtbaren Aktionsraum der Sängerin eingrenzen.

Es sollte wie in einem virtuellen Raum wirken, von sich aus entfremdet, wie in einer Art Videospiel, in dem es künstliche, scheinbar undurchdringbare Barrieren gibt. So plante ich, diese Räume – ähnlich wie in einem meiner vorher komponierten Stücke, Table Talk (2016) – mit hart begrenzten Lichtfeldern zu erschaffen (s. auch Abb. 4), sodass diese den sichtbaren Aktionsspielraum für Anne-May vorgaben. Später sollten auch geschriebener Text, emojiartige Fratzen und schließlich Anne-Mays virtuelle Avatare auf der Projektionsfläche zu sehen sein.

Diese Ideen flossen bereits in die ersten Textskizzen in Form von Anmerkungen zu Licht und Video mit ein. Die außermusikalischen Ideen fanden Eingang in die Partitur und wurden wie die Musik selbst zeitlich determiniert komponiert.
Das Stück beginnt in vollkommener Dunkelheit, und die Protagonistin tappt ebenfalls im Dunkeln. Anne-May gibt vokale Gesten, Atem- und Klicklaute von sich, die mit der sich ändernden Umgebung zusammenfallen und auf die Umgebungsänderungen reagieren oder diese triggern, jedoch immer das falsche und für Anne-May unerwünschte Resultat zur Folge haben. Sie ist auf einer klanglich-emotionalen, aber textlich nicht artikulierten Ebene bereits voll mit der Maschinerie verwoben. Die Gestenklänge und Klicklaute sind so dicht gestrickt, dass sie bereits einen musikalischen Klangteppich erzeugen, der den spärlichen Text trägt. Der Text selbst wächst oft aus diesem Klangteppich heraus, sodass die Anfangs- oder Endvokale mit den Schluss- oder Initialklängen der Gestenlaute verbunden sind. Damit changiert das Stück ständig zwischen der konkreten Sprache und dem darunterliegenden Klangteppich, wirkt dabei aber trotzdem wie eine Einheit. Man könnte so weit gehen und sagen, dass die musikalische Schicht der Gesten und Vokalfetzen auf ihre Art intellektuell entfremdet vom Realen, vom Klartext seien.

Betrachtet man das Verhältnis zwischen den unkonkreten und den textlich fixierten Vokalaktionen, so ergibt sich für die ersten neun Takte ein Verhältnis von 54 : 1 (vgl. auch Abb. 7).

Dieses Verhältnis ändert sich zwar im Laufe des Stücks zugunsten des Texts, doch inhaltlich wendet sich der Text im Nachhinein gegen die Protagonistin. Im Kompositionsprozess kristallisierte sich heraus, dass ich mehr Inhalt über die unkonkreten Ebenen der Komposition vermitteln kann als über den Text und das Textskript. Der Text selbst blieb also absichtlich „doof“, krude und einfach, doch die Performance und die Leistung, die Anne-May erbringen muss, ist in jedem Moment höchst fordernd: Sie ist immer musikalisch, intellektuell sowie koordinativ virtuos. Durch die starke Fragmentierung des Texts und das Durchmischen mit den Gestenklängen bekamen – in Kombination mit dem sich wandelnden Setting – auch die Gesten und die unkonkreten Vokalaktionen ein sich stetig wandelndes emotionales Moment. Dies faszinierte mich: die Spannung, die entsteht, wenn man etwas Hochsensibles auf das Einfache und Unausgegorene prallen lässt. Ich konzentrierte mich darauf, eine hohe Dichte an schnellen, scharfen, emotionalen Wechseln herzustellen und über die Ebenen hinweg eine Polyphonie der Emotionen zu stricken, die sich aus Erwartung, Hoffnung und Scheitern knüpft.
Nach dem Beginn werden das Prinzip des Stücks, die Vortragsart und die Interaktion mit der Umgebung schnell klar. Die Geschichte beginnt in dem Moment, in dem die Sängerin sich mit sich selbst befasst, also die etablierten Situationen wiederholt werden und über sie gesprochen wird. Es ist eine selbstreferenzielle Geschichte, die sich mit immer neuen Variationen im Kreis zu drehen scheint. Die eigentliche Lecture, die das Singen und die Produktion von Tönen mit der menschlichen Stimme thematisieren soll, gerät zunehmend aus den Fugen und die Maschine übernimmt mehr und mehr die Kontrolle. Die Protagonistin erkennt früher oder später, dass die Maschinerie ihr gegenüber im Vorteil ist, denn Licht ist schneller als Schall. Alles scheint an dieser physikalischen Hürde zu scheitern, dass sich die Entfremdung schneller als Schall verbreitet und die Protagonistin mit ihren Mitteln selbst keine Chance hat. Ihr letzter Ausweg ist der harte Reset, das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Alles ist außer Kontrolle und sie muss den Notschalter drücken, einen Neustart der gesamten Situation hervorrufen, um diesen „fatal error“, in dem sie sich befindet, kurzzuschließen.
Das Stück beginnt wieder von vorne, es spielt sich wieder ähnlich ab, doch diesmal geht es weiter, Anne-May schreitet erfolgreicher, schneller und zielgerichtet in ihrer Lecture voran. Nur, dass sie nun begleitet wird von einer Reihe digitaler Avatare, die mit ihr in einem ständigen Diskurs stehen, ihr Wörter oder Phrasen vorwegnehmen, im Mund umdrehen und ihre Rolle als Protagonistin nach und nach untergraben. Sie sind Teil der Maschinerie, die sich immer offensichtlicher als Gegenspieler und autonomer Charakter etabliert. Die Diskussion zwischen Anne-May und ihren Avataren dreht sich im Kreis, wird nach und nach ad absurdum geführt, bis sie innerhalb ihrer Lecture beim Primärschall hängenbleiben, dem ersten Schall, der die Stimmlippen in Schwingung versetzt. Anne-May sieht ihre Chance, die Maschinerie durch Primärschall zu überlisten, mit ihren eignen Mitteln.



Der Primärschall wird zu einem Mysterium, einem Fantastikum, und die Diskussion spitzt sich auf diese Begrifflichkeit zu, bis letztlich die Lösung klar vor Augen liegt, „less is more“: Durch eine Primärschallperformance wäre die Hoffnung gegeben, schneller als das Licht zu singen („of course!“), die Maschinerie hinter sich zu lassen. Die Primärschallperformance scheitert allerdings an der Maschinerie und den mit eingebunden Avataren. Es wird klar, dass die Maschinerie sie ausgetrickst hat und ganz nach dem Motto „more is more & less is less“ handelt.
Für mich entsteht innerhalb des rund 20-minütigen Stücks ein starker Gegensatz zwischen der vordergründig dystopischen Entfremdungsgeschichte und dem virtuos-musikalischen Abenteuer, das sich auf der performativen Ebene abspielt. Es kommt mit extrem reduzierten musikalischen Mitteln aus, die durch Kombination und Variation eine breite Palette an wechselnden Klangfarben und intensiven, wechselnden Emotionen erzeugen. Die Musik selbst ist es, die sich für mich in ihrer Wirkung und Intention dem vordergründig dystopischen Narrativ entgegensetzt, denn sie trägt auf ihrem Rücken das offensichtlich Platte, das „Doofe“ und Oberflächliche, zur Schau und verwandelt es spielerisch, mit einer gewissen Eigendistanz, in etwas Neues. Die verstiegene, kontinuierlich sich steigernde Komplexität der musikalischen Textur, die ständige Variation in der Repetition auf der Seite der Komposition und letztendlich das daraus resultierende musikalische Erlebnis, die von der Interpretin gemeisterte Hürde der performativen Überforderung stehen in starkem Kontrast zur Entfremdungsmaschine. Der musikalische Subtext sozusagen sagt etwas anderes und verleiht dem Stück eine wahrnehmbare Spannung und eine direkt zugängliche Ambivalenz.
Der Umgang mit musikalisch extrem reduziertem Material folgt dem Prinzip „less is more“ und schöpft daraus ein Konzept der Materialentwicklung. Diese Entwicklung basiert auf der musikalisch-emotionalen Variation und wird durch die kontinuierliche Neukontextualisierung des bereits gegebenen Materials befördert. Die von mir etablierte Verbindung der Musik und des Klangs mit den verschiedenen außermusikalischen Darstellungsformen wie Video, Performance etc. ermöglichen es mir, das Material ständig neu zu erfinden, andere Bedeutungen oder einen anderen Kontext zu geben. Und für mich ist genau das spannend: etwas zum Glitzern zu bringen, was von sich aus nicht glänzt, ein Luftschloss des Absurden zu konstruieren, mit vielen verschiedene Blickwinkeln und Fenstern, in denen es schimmert und glitzert, in die man neugierig hineinblicken kann.
Das Prinzip der Reduktion, des „less is more“, ist also maßgeblich für die musikalische Entwicklung und im Ausgangsmaterial verankert. Die Einfachheit, mit der das Material angelegt ist, lässt einen großen Spielraum für Permutationen und Neuverknüpfungen und erhält durch die hohe Ereignisdichte der Musik in Kombination mit Video, Licht und Elektronik die performative Spannung.



Aus der Ausführung der notierten Musik erwachsen auch die außermusikalischen Performance-Anteile in der Factory. Die Musik an sich steht durch ihre strukturelle und kompositorische Gegebenheit in ständiger Reibung mit der letztendlich durch die Entfremdung selbst artikulierten Idee, des „more is more“. Und die Performance ist ihr Mittler, ein Zwischending, das sich nicht genau festlegen lässt, aus der jeder seine Interpretation ziehen kann, ein bisschen wie in unserer Realität.
Wir oszillieren tagtäglich zwischen richtig und falsch, zwischen den ethisch korrekten Lösungen für unsere Probleme und den einfachen pragmatischen Entscheidungen, die vielleicht nicht immer zu Ende gedacht sind. Mich selbst interessiert dieser Grenzbereich, dieser intrinsische Konflikt – und ich denke, in der Factory wird diese Spannung erlebbar, der ewige Kampf zwischen der Genügsamkeit und dem Maßlosen.
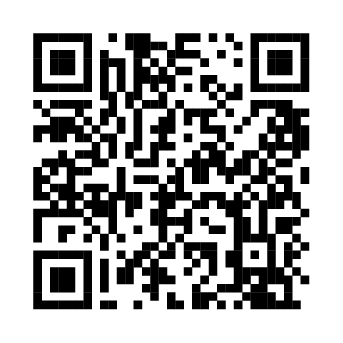
In der SLUB-Mediathek öffnen.
http://mediathek.slub-dresden.de/vid90002528.html
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Stimme und Person in der Philosophischen Anthropologie.
- 2. Gesangstechniken in der zeitgenössischen Vokalmusik
- 3. Sologesang des 20. und 21. Jahrhunderts
- 4. „The Alienation of the Singer from Her Gattungswesen“
- 5. Stimme im 21. Jahrhundert
- 7. Die Schönheit des Dazwischen in Vokalmusik
- 8. Den eigenen kulturellen Hintergrund überdenken
- 9. Die eigene Stimme finden
- Kurzbiografien
- Bildnachweis