Fragen zur Aufführungspraxis
von Luigi Nonos La fabbrica illuminata (1964)1
(Anne-May Krüger)
Un nastro di musica elettronica, quando viene prodotto, non è affatto stabilito definitivamente. […] La dinamica e il carattere della mia musica, anche di quella elettronica, dipendono dalle condizioni date della sua esecuzione, dalle reazioni dell’ascoltatore e degli interpreti, e io stesso devo poter reagire a questo.2
Nicht wirklich definitiv feststehend sei ein Tonband mit elektronischer Musik, so Nono à propos seines Bühnenwerks Al gran sole carico d’amore (1975). Entscheidende Impulse für Dynamik und Charakter dieser Musik ergäben sich aus den jeweiligen Aufführungsumständen, auf die auch er reagieren müsse. Nono spricht hier aus seiner Position als Komponist. Umgekehrt stellt sich auch für Interpretierende die Frage, inwiefern in der Arbeit mit sogenannten fixed media ein Reagieren auf die aktuelle Aufführungssituation auch nach Nono möglich oder auch legitim sein kann. Mag Nono als Autor in der Lage sein, die Dauern der Tonbänder während der Probenarbeit im Dialog mit Regisseur und Dirigent anzupassen bzw. Letztere zu autorisieren, nach den Notwendigkeiten der Szene zu verfahren, befinden sich Interpretinnen und Interpreten in Abwesenheit von Nono in einer grundsätzlich anderen Situation. Wie ist umzugehen mit den unter spezifischen technischen, personellen, aber auch gesellschaftlichen Bedingungen produzierten fixen Komponenten, die einerseits unabdingbarer Teil eines Kunstwerks sind, deren Einsatz in der musikalischen Praxis jedoch andererseits zu Konflikten führt?
Ein aussagekräftiges Beispiel für diese vielschichtige Problematik stellt Nonos Komposition La fabbrica illuminata (1964) für Sopran und vierkanaliges Zuspielband, basierend auf Texten von Giuliano Scabia (1935–2021) und Cesare Pavese (1908–1950), dar. Es handelt sich hierbei um Nonos erste Arbeit, in der er Tonaufnahmen produziert, die unterschiedliche Klangmaterialien miteinander verbindet und im Studio elektronisch bearbeitet. Auch die Verbindung von Live-Interpretin und Tonband erprobte Nono erstmals in diesem Kontext. Die Entstehungsgeschichte der für Carla Henius geschriebenen Komposition wurde u. a. durch Nina Jozefowicz3 ausführlich aufgearbeitet. Jozefowicz legt nicht nur eine Chronologie der Entstehung von Tonband und Vokalpartitur dar, sondern untersucht auch die Verwurzelung des Stücks in Nonos nicht realisiertem Musiktheater Un diario italiano. Besonderen Fokus legt sie auf die unterschiedlichen Arbeitsmodi im Entstehungsprozess von Tonband und Partitur.
Die hier zu verortende Kooperation zwischen Henius und Luigi Nono hat sowohl in Form musikwissenschaftlicher als auch theaterwissenschaftlicher Studien einige Beachtung erfahren.4 Allerdings stand die Frage der Aufführungspraxis, die durch diese Zusammenarbeit nachhaltig beeinflusst wurde, bisher kaum im Zentrum des Interesses,5 obwohl gerade aus dem in der Fabbrica prominent eingesetzten Zuspielband zahlreiche Fragestellungen erwachsen. Durch die Verschränkung musikpraktischer und musikologischer Untersuchungsansätze problematisiert die vorliegende Studie gerade die Arbeit mit dieser Fixed media-Komponente und verdeutlicht die Notwendigkeit einer kritischen Prüfung der Aufführungstradition von La fabbrica illuminata.
Materialien und Hintergründe
Der Entstehungsprozess von La fabbrica illuminata hat eine umfassende Dokumentation durch die Uraufführungsinterpretin selbst erfahren. Carla Henius’ Arbeitsnotizen und Erinnerungen ebenso wie ihre Korrespondenz mit Luigi Nono geben Auskunft sowohl zu technischen Grundbedingungen wie auch über Nonos gesellschaftspolitische Haltung zu Beginn der 1960er Jahre. Zudem lassen sie Rückschlüsse über die Art der Zusammenarbeit zwischen Komponist und Interpretin zu und zeigen aufführungspraktische Probleme auf, die offenbar bereits zur Entstehungszeit der Fabbrica bestanden. Zentrale Quellen hierfür liegen mit Henius’ Einspielung der Fabbrica für das Label Wergo sowie mit der in der Basler Paul Sacher Stiftung lagernden Aufführungspartitur der Sängerin6 und einer weiteren im Archivio Luigi Nono Venedig (ALN) befindlichen handschriftlichen Partitur vor. Henius’ Aufführungsmaterialien sind insofern von besonderer Bedeutung, als im Rahmen der Restaurierung des Dokuments unter von Nono vorgenommenen Überklebungen einiger Passagen eine frühere Fassung der Komposition sichtbar wurde. Diese gibt Hinweise auf konzeptuelle Anlagen, die teilweise verworfen wurden – beispielsweise die fast auf jeder Note vorgesehenen mikrotonalen Inflexionen, von denen in der Endfassung nur zwei im Finale erhalten blieben –, deren Übertragung in die Druckfassung aber womöglich auch versehentlich nicht erfolgte. Auch handschriftliche Skizzen Nonos sowie Tondokumente, vornehmlich aus dem Bestand des ALN, wie die Kompilation der von Henius im Tonstudio generierten und anschließend von Nono montierten Vokalmaterialien,7 erwiesen sich für die Rekonstruktion des Arbeitsprozesses als äußerst aufschlussreich.
Wesentliche Grundlage für die Forschung stellt weiterhin die Kritische Ausgabe8 der Partitur (hrsg. von Luca Cossettini) dar, in der sowohl die existierenden Zuspielbänder als auch Aufführungs- und Druckpartituren untersucht und mit Erfahrungsberichten von Aufführungsbeteiligten kontextualisiert wurden, die in direktem und teilweise engstem Kontakt zu Nono standen. Cossettini hat zudem in Zusammenarbeit mit dem Labor MIRAGE der Universität von Udine die Audio-Dokumente analysiert und unter Berücksichtigung der ursprünglichen Produktionsumstände restauriert und digitalisiert. Gleichzeitig fand auch eine physikalische Analyse der Bänder statt. Hier konnten anhand der sichtbaren Schnittstellen Arbeitsprozesse auf der Ebene der Tonbandkomposition nachvollzogen und damit auch Ursachen für Probleme beispielsweise in der Koordination von Band und Live-Stimme herausgearbeitet werden. Die umfangreiche Materialsammlung sowie die auf der Auswertung jener Dokumente basierende Kritische Ausgabe verdeutlichen und kommentieren nicht nur Fehler und Unschärfen der Aufführungsmaterialien, sondern entwerfen punktuell auch Lösungsansätze für die musikalische Umsetzung der Partitur.9 Damit wurden wesentliche Vorarbeiten geleistet, auf deren Basis im Rahmen eines experimentellen Settings Ansätze entwickelt werden konnten, um mögliche Lösungen nicht nur zu benennen, sondern in der Praxis zu evaluieren und weiterzutreiben. Dazu gehört im vorliegenden Fall die Einstudierung der Komposition mit den Materialien der Kritischen Ausgabe sowie auch mit einem partiell neu erstellten Zuspielband.
Aufführungspraxis
Mit welchen Problemen sehen sich nun die Interpretinnen und Interpreten10 der Fabbrica konfrontiert? Luca Cossettini verweist hier auf die Textebene:
The textual problems in La fabbrica illuminata derive from the fact that there are two coexisting musical dimensions with different systems of notation.11
Aus aufführungspraktischer Perspektive bedeutet das: Interpretationspraktische Probleme in La fabbrica illuminata entstehen aus dem Umstand, dass darin zwei musikalische Ebenen mit unterschiedlichen Notationstechniken und Darbietungsmodi koexistieren. Dabei lässt sich die Ebene der Live-Performerin als eine auf der Basis der Partitur im Moment entstehende Schicht beschreiben, während das Tonband als fixe Komponente seit seiner Entstehung unverändert geblieben ist.12 Wenn man in musikalischer Interpretation von der Notwendigkeit der Aktualisierung13 ausgeht, ergibt sich für das Tonband die Problematik, dass im Unterschied zur Live-Komponente diese Aktualisierung naturgemäß nicht realisierbar ist. Während also die Live-Interpretin auf die seit der Entstehung der Komposition vergangene Zeit reagieren, das heißt ihre im Moment stattfindende Performance sowohl mit der Entstehungszeit der Fabbrica als auch mit vergangenen Interpretationen und deren Umständen kontextualisieren kann, bleibt das Tonband fixiert in seinem ursprünglichen akustischen und von der Gegenwart abgekoppelten Zustand. Guy E. Garnett kommentiert dieses Phänomen pointiert:
[Electroacoustic tape music] is simply out of touch with what is needed to rejuvenate art – out of touch with what Adorno described as the quality of being stimmig, that is, being coherently harmonious with the needs of the times in which they are created and exist. […] One could therefore come to consider electroacoustic music as the ultimate „museumification“ of musical art.14
Die Problematik der „Musealisierung“ erweist sich im Fall von La fabbrica illuminata als besonders prägnant, ist hier doch nicht nur die ästhetische, sondern gerade auch die gesellschaftspolitische Ebene betroffen. Die Komposition, gewidmet den Arbeitern des Stahlwerks Italsider (Genua), zielte auf das Sichtbarmachen prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse von Beschäftigten in der Industrie. Dass Nono mit der Anprangerung von Missständen gerade im Vorzeigewerk Italsider einen Nerv getroffen hatte, lässt sich aus dem Verbot der Aufführung im Rahmen des Premio Italia schließen, für dessen Eröffnungsveranstaltung die Komposition in Auftrag gegeben worden war. Die kompositorische Bezugnahme auf die Arbeitswelt des Stahlwerks durch die Integration von O-Tönen aus dem Walzwerk – Maschinenlärm, Zischen etc. – sowie Zitaten aus den Arbeitsverträgen der Beschäftigten in das Zuspielband hatte 1964 offenbar ausreichendes Provokationspotenzial, um ein Eingreifen von Seiten der RAI hervorzurufen, dürfte heute jedoch vor allem als historisches Dokument dieser gesellschaftlichen Spannungen rezipiert werden. Auch die in der Fabbrica mitschwingende Dichotomie Mensch/Maschine mit ihrem Bedrohungsszenario des von zunehmender Mechanisierung dominierten Menschen besitzt heute andere Implikationen als zur Entstehungszeit der Komposition.15 Zweifellos unterscheidet sich damit die Rezeption gerade der gesellschaftspolitischen Dimension der Fabbrica mehr als 50 Jahre nach ihrer Uraufführung grundsätzlich von jener der 1960er Jahre.
Mit dem historischen Tonband zusammenhängende Problemstellungen werden auch auf konzeptioneller Ebene deutlich. Nono verarbeitete darin neben synthetischen Klängen, O-Tönen sowie gesungenen und gesprochenen Chorpassagen auch Material, das Carla Henius in mehrstündigen, vom Komponisten angeleiteten Improvisationen im Tonstudio der RAI in Mailand produzierte. Die Verdopplung der Gesangsstimme bzw. die Verschmelzung von Live-und Tonbandstimme stellte in der kompositorischen Anlage des Stücks offenbar ein zentrales Element dar: Nono zufolge entwickelte der Tontechniker des Studio di Fonologia, Marino Zuccheri,16 explizit Aufnahmetechniken, die ein Unterscheiden von Live- und Tonbandstimme verunmöglichen sollten.17 Henius selbst berichtet dem Freund Theodor W. Adorno kurz nach der Uraufführung über die Arbeit am Tonband:
Ich war viermal in Mailand im studio fonologia, wo ich über diesen Scabia- und Pavese-Text improvisiert habe, […] aus diesem Material hat er [Nono] dann ein Band für vier Kanäle hergestellt, mit Chören und elektronischen Klängen. Dazu normal komponierte Gesangspartien, die ich in meine eigenen Bänder live hineinzusingen hatte. Es war ungefähr so, als würdest du etwas sagen und hörtest gleichzeitig all deine Gedanken.18
Die Ununterscheidbarkeit der solistischen Vokalklänge auf dem Tonband von der Live-Stimme stellte damit offenbar ein wesentliches Gestaltungselement der Komposition dar. Die auf dem Band besonders im zentralen Abschnitt Giro del letto deutlich erkennbare Stimme Henius’ steht jedoch nunmehr den Stimmen der ihr nachfolgenden Interpretinnen gegenüber – zwangsläufig kommt es mithin zu einem Eingriff auf der Ebene des kompositorischen Konzepts.19
Fragestellungen ergeben sich in der Umsetzung auch aus den Tonhöhenabweichungen, die das Zuspielband an mehreren Stellen zu den in der Partitur angegebenen Stichnoten20 aufweist. Wie in der Kritischen Ausgabe aufgearbeitet, handelt es sich hier um Diskrepanzen, die u. a. durch das Kopieren des Zuspielbands auf einem defekten Abspielgerät zustande kamen.21 Das scheint z. B. für die Passage auf Partiturseite 6, 3. System (8’59’’) zuzutreffen.22 Laut Kritischer Ausgabe wäre hier das live zu singende es2 vom Ton des Bands (ebenfalls es2) abzunehmen. Auf der Wergo-Einspielung setzt Henius auch auf exakt der Tonhöhe des Zuspielbands ein – und damit in Relation zur Partitur zu tief, denn auf dem Band erklingt ein Ton zwischen d2 und einem um ca. einen Viertelton zu tiefen es2. Hier scheint also durch falsches Kalibrieren der Abspielgeräte eine Tonhöhenabweichung des Zuspielbands entstanden zu sein, die die Interpretin ausgleichen muss, soll der Einklang zwischen Band und Live-Sängerin erhalten bleiben.
Andere Abweichungen lassen sich jedoch nicht allein durch ein verlangsamtes Überspielen erklären. Dies betrifft beispielsweise eine weitere Passage im Giro del letto überschriebenen Abschnitt (Partitur S. 5, Anfang des 3. Systems). Cossettini geht im Kommentar zur Kritischen Ausgabe davon aus, dass Nono durch zahlreiche Änderungen an der Partitur die ursprünglich vorgesehenen Intervallverhältnisse zwischen Tonband- und Live-Stimme aus den Augen verloren habe.23 Tatsächlich scheint eine frühere Version der genannten Passage, die sich unter einer Überklebung in Carla Henius’ Aufführungspartitur befindet, für diese Annahme zu sprechen (s. Abb. 1a–c).

Durch die ursprünglich von fis2 über g2 nach gis2 geführte Linie hätte sich mit der sowohl im Basler Manuskript als auch in der im Archivio Luigi Nono lagernden Partitur noch sichtbaren, jedoch durchgestrichenen Stichnote vom Band (gis2) ein Einklang ergeben. Nono transponierte diese Passage – wie auch einige andere – in eine tiefere Lage: Der chromatische Aufstieg beginnt nun am Ende des 2. Systems mit as1 und geht über a1 nach b1. Als Stichnote gibt Nono in der Partitur jedoch nun h1 an, statt des zu erwartenden b1. In beiden Handschriften sieht man jedoch das „o“ des Textbestandteils „fermano“, das auf gleicher Höhe notiert ist wie die Stichnote, in das Vorzeichen b verwandelt.

In die Druckpartitur fand dieses Vorzeichen jedoch keinen Eingang, sodass auf das zu singende b1 ein notiertes h1 als Stichnote trifft. Vom Band zu hören ist jedoch keiner der beiden notierten Töne, sondern ein zwischen gis1 und a1 oszillierender Ton, wie dies auch in der Kritischen Ausgabe beschrieben wird.24
Damit scheint sich anzudeuten, dass es sich an dieser Stelle in der Version für die Druckausgabe um einen Übertragungsfehler handelt, auch wenn nicht mit absoluter Gewissheit ausgeschlossen werden kann, dass Nono die Intervallverhältnisse in der Transposition bewusst veränderte. Es spricht aber einiges für die Annahme, dass Live- und Tonbandstimme an dieser Stelle auf derselben Tonhöhe miteinander hätten verschmelzen sollen. Anhaltspunkte dafür finden sich in der Konzeption der Fabbrica selbst, aber auch in weiteren Vokalkompositionen des zeitlichen Umfelds wie in „Ha venido“ Canciones para Silvia (1960) und Intolleranza 1960, in denen das Verschmelzen verschiedener Stimmen im Unisono eine wesentliche dramaturgische Funktion besitzt.

Ivanka Stoïanova benennt hier als einen zentralen Aspekt jenen der Verräumlichung, der sich in Nonos Vokalkompositionen der 1950er und 1960er Jahre gerade in der Textbehandlung manifestiere. Die Ausbreitung der Textvertonung in der Zeit (horizontal), im Sinne der Anordnung von Tonhöhen (vertikal) und in der Verteilung der klanglichen Schichten (Tiefe), führe mitunter zu einem Verwischen der sprachlichen Bedeutung, öffne gleichzeitig aber einen dreidimensionalen Klangraum und resultiere zudem in einer Bereicherung der Klangfarbe.25 In „Ha venido“ erklingen mit einem solistisch besetzten Frauenchor (sechs Soprane) und dem Sopran-Solo sieben gleiche Stimmen, die sich aus dem Einklang akkordisch auffächern oder nacheinander unisono übereinandergeschichtet werden. Auch bei maximaler stimmfarblicher Angleichung dürften diese kleinsten Abweichungen untereinander aufweisen, sodass ein leichtes Oszillieren der Tonhöhe, des Vibratos bzw. des Timbres und des Timings die Farbe im Gesamtklang in eine permanente Bewegung versetzt. Gleichzeitig mag die Wahl von sieben gleichen Stimmen, darunter eine Hauptstimme, und ihr Einsatz in homo- und polyphonen Verläufen gerade vor dem Hintergrund literarischer Entwicklungen seit u. a. Joyce26 auf eine Auseinandersetzung mit dem Individuum und seiner Vielschichtigkeit hindeuten. Das wiederkehrende Verschmelzen der solistischen Gesangslinie mit einzelnen Chorstimmen auf derselben Tonhöhe führt dabei zu immer neuen Dichtekonstellationen zwischen den Stimmen, aber auch zum punktuellen Verschwinden der Solistin im Gesamtklang.27
In La fabbrica illuminata ist hier der Abschnitt Giro del letto von besonderem Interesse. Anders als die übrigen Teile bezieht dieser sich auf die private Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter: Der Wortlaut des Titels (Umkreisen des Betts) entstammt offenbar dem Fabrikjargon und bezeichnet die Situation eines Schichtarbeiterpaares, das sich das gemeinsame Bett nicht mehr teilen kann, da die Arbeitszeiten es nicht zulassen.28 Die im Titel anklingende Intimität spiegelt sich dabei nicht primär auf semantischer, sondern vor allem auf musikalischer Ebene wider. Fabrikgeräusche, Chorgesang und synthetische Klänge treten klar in den Hintergrund, dagegen ist die solistische Stimme auf dem Band besonders exponiert. Ihr Zusammenspiel mit der Live-Stimme – zumal in den gehäuft auftretenden Stimmbewegungen aus dem Einklang in die Aufspaltung beider Stimmen bzw. aus dem Mehrklang hin zum Einklang – lässt sich als Entsprechung für die Situation des Arbeiterpaares zwischen Einheit und Trennung deuten.
Als Sonderfälle müssen zwei Passagen in Giro del letto gelten, da sich aus den unterschiedlichen Quellen das von Nono intendierte Tonverhältnis zwischen Live-Stimme und Tonband nicht zweifelsfrei feststellen lässt (s. Tabelle 1). Die erste der zwei aufgelisteten Passagen wird im Folgenden Gegenstand ausführlicher Untersuchungen sein.
| Seite/System | Zeitangabe | Live zu singender Ton | Interaktion mit dem Band | Bemerkungen |
| 5/3 | 7’02’’–7’03’’ | b1 | Laut Partitur ergibt sich eine kleine Sekunde zwischen live gesungenem b1 und h1 vom Band. | Gesang vom Band stammt von Henius; statt des notierten h1 ist ca. a1 zu hören; Manuskripte (ALN und Basel) verzeichnen b1 als Stichnote. |
| 6/3 | 8’59’’ | es2 | In der Partitur sind keine Angaben zum Tonhöhenverhältnis zwischen Live- und Bandstimme enthalten. Auf dem Band erklingt an dieser Stelle eine Tonhöhe zwischen ca. d2 und einem um ca. ¼-Ton zu tiefen es2 vom Frauenchor. | Auf der Wergo-Einspielung nimmt Henius den Ton unisono ab, d. h., statt des notierten es2 singt sie zwischen ca. d2 und einem um ca. ¼-Ton zu tiefen es2. Da die live zu singende Vokallinie chromatisch abwärts geführt wird, ergibt sich in jedem Fall ein Unisono (vgl. Partitur, S. 6). |
Diese Bewegung der beiden Gesangslinien zueinander hin bzw. aus der Verschmelzung voneinander weg findet sich nur in diesem Abschnitt. Das entsprechende Klangmaterial auf dem Band stammt nicht ausschließlich, jedoch überwiegend von Henius. Mit der Präsenz der solistischen Stimme tritt damit das Individuum in den Vordergrund – auch dies eine dramaturgisch schlüssige Entsprechung zu dem hier stattfindenden Perspektivwechsel weg von der Masse der Arbeiterschaft hin zur Einzelperson.
Gleichzeitig lassen sich diese Stimmbewegungen auch hier im Sinne einer Verräumlichung deuten. Wie Nina Jozefowicz schreibt, realisierte Nono in „La fabbrica illuminata seine Vorstellung einer spezifischen Raum-Klang-Ästhetik, die zum Ziel hatte, die Linearität des Klanggeschehens durch eine Mehrdimensionalität zu ersetzen“.29 Diese Mehrdimensionalität ist sowohl in der Verbindung verschiedener Klangquellen und der Kombination von Live-Interpretin und Zuspielband als auch in der tatsächlich räumlich konzipierten Aufführungssituation nachvollziehbar. Das Zusammenwirken der genannten Stimmbewegungen aufeinander zu und voneinander weg mit Verräumlichungseffekten durch die Anordnung der Lautsprecher sowie die damit verbundene Bewegung des Klangs im Raum dürfte zudem zu einem Oszillieren des klanglichen Fokus führen, indem die Aufmerksamkeit zwischen den sich bewegenden Klängen der Lautsprecher und dem räumlich fixen Klang der Live-Interpretin fluktuiert. Nonos Konzept, Band- und Live-Stimme möglichst ununterscheidbar zu machen, dürfte diesen Effekt noch verstärkt haben.
Aus den genannten Beispielen lässt sich ablesen, dass die Arbeit mit Einklängen sowie deren Auffächerung bereits im Vorfeld der Entstehung von La fabbrica illuminata ein von Nono gezielt eingesetztes kompositorisches Verfahren darstellte. Dieses lässt sich sowohl aus struktureller als auch aus konzeptionell-inhaltlicher bzw. dramaturgischer Perspektive verstehen. Im Abschnitt Giro del letto scheint Nono so einerseits den Komplex des Privatlebens der Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter aufzugreifen, andererseits erzeugt er mit dem Weben zwischen Einklang und Mehrklang eine Dynamisierung der klangfarblichen Nuancen und Dichteverhältnisse, resultierend in permanenten Verschiebungen jener von Stoïanova beschriebenen räumlichen Ebenen.
Zwar kann damit nicht abschließend bewiesen werden, dass Nono in der fraglichen Passage von Giro del letto auch noch zum Zeitpunkt der Drucklegung ein Unisono zwischen Live- und Bandstimme intendierte, durch die Transposition jedoch das Vorzeichen einfach aus den Augen verlor. Die vorhandenen Indizien scheinen allerdings dafür zu sprechen, dass die unter der Überklebung in der Basler Aufführungspartitur enthaltene Linie, die tatsächlich in einem Unisono zwischen Band- und Live-Stimme endet, auch auf die Transposition anzuwenden wäre. Damit steht die Sängerin in der Aufführungssituation hier vor der Entscheidung zwischen drei Möglichkeiten:
- am Ende der genannten Phrase wie notiert b1 zu singen. Das Ergebnis wäre ein Intervall zwischen b1 (live) und etwa a1 (Tonband).
- unter der Annahme, dass Nono eine kleine Sekunde intendiert habe, die Oberstimme dabei jedoch vom Band zu kommen hätte, die gesamte Phrase entsprechend zu transponieren, um in etwa bei gis1 zu enden.
- in Anlehnung an die rekonstruierte erste Version, die in einem Einklang (gis2) endete, die Passage so zu transponieren, dass sie ebenfalls in einem Einklang, also auf dem ungefähren a1 des Tonbands, endet.
Keine der genannten Varianten erweist sich jedoch als konfliktfrei, da in jeder die Partitur nur teilweise berücksichtigt werden kann bzw. sogar konterkariert werden muss, indem von den notierten Tonhöhen bewusst abgewichen wird.

Deutlich wird die Problematik auch im Finale des Stücks (S. 8f., s. Abb. 2). Auch hier stimmen die angegebenen Stichnoten (h1, e2, fis2) nicht mit den Tonhöhen auf dem Zuspielband überein. Sie erklingen in etwa jeweils einen Halbton tiefer. Zusammen mit dem live zu singenden f1 würde sich so statt einer übermäßigen eine reine Oktave ergeben. In der Kritischen Ausgabe wird daher folgende Lösung empfohlen:
If the finale is sung at the written pitch, this produces an octave between the voice and the tape. Therefore, to re-establish the dissonance of an augmented octave, preserving the structural integrity, the singer should transpose the entire section down a semitone.30
Dieses Vorgehen wird u. a. auch von Liliana Poli (1928–2015) beschrieben, einer der ersten Interpretinnen der Fabbrica nach bzw. parallel zu Henius,31 und entspricht der aktuell gängigen Praxis.
Die genannten Lösungen greifen damit auf derjenigen Ebene des Stücks ein, die im performativen Kontext am ehesten Möglichkeiten bietet, zu variieren bzw. zu reagieren: die live zu singende Schicht. Hier ließe sich fragen, ob statt des Eingriffs in den geschriebenen Notentext im Moment der Aufführung nicht auch ein entsprechendes Vorgehen für die fixe Komponente denkbar wäre. Grundlage dafür wäre ein Verständnis von Band wie Partitur als Text.32
Tradierung
Tatsächlich mögen vor allem zweierlei Beweggründe dafür ursächlich sein, dass entsprechende Korrekturen am Band üblicherweise nicht vorgenommen werden. Zum einen stellt eine solche Modifikation einen nicht unerheblichen technischen Aufwand dar, zum anderen ergeben sich Hürden für eine Neuinterpretation des Bandes gerade aus einer Eigenheit elektronischer Musik, die für Danuser das Band zum Text, also zur Grundlage analytischer Betrachtung, werden lässt: Wie auch im Fall der Fabbrica existiert häufig keine ausreichend detaillierte Realisationsvorlage, die eine Neuinterpretation im Sinne einer kritischen Ausgabe des Tonbands ermöglichen würde. Cossettini führt mit Blick auf das oben genannte Beispiel der Stichnote für das Finale noch weitere Gründe an, die eine Manipulation am Band aus seiner Sicht verunmöglichen:
[L]a nota „sbagliata“ è solo una delle voci di un coro, per cui non può essere elaborata separamente; impossibile anche scegliere oggettivamente da dove iniziare a trasporre – ci si deve, ad esempio, limitare alle tre note trascritte in partitura o bisogna modificare tutto il corale? –; poi ci sono le difficoltà, spesso insormontabili, che si incontrano nel segmentare il continuum del tessuto sonoro. […] D’altro canto potrebbero anche sorgere forti e fondati dubbi sulla liceità di questa operazione: considerare errato il nastro in base ad una sua descrizione – e non prescrizione – in partitura e, sulla base di questo assunto, correggerlo, creando un tessuto sonoro che non è mai esisto realmente.33
Cossettinis Einwände sind nicht grundsätzlich von der Hand zu weisen. In der Tat mag es mitunter schwerfallen zu entscheiden, wo eine Transposition ansetzen sollte, das heißt, ob nur in der Partitur vermerkte Stichnoten angepasst werden müssten oder größere musikalische Zusammenhänge. Fraglich ist auch, ob sich ohne Realisationsvorlage ausreichend Informationen herausarbeiten lassen, um das von Nono geschaffene Klanggewebe nicht zu zerstören.
Zweifelhafter erscheint Cossettinis Argumentation, eine solche Modifikation würde auf der Basis einer nachträglichen Beschreibung des Tonbands stattfinden – gemeint ist die stark vereinfachte Darstellung von Klangverläufen in der Klangregie-Partitur bzw. der Aufführungspartitur, die vor allem der Koordination zwischen Sängerin und Band dient –, und nicht auf der Grundlage einer Vor-Schrift, also einer vor der Erstellung des Bands konzipierten Vorlage. Damit würde ein Klanggewebe geschaffen, das so nie existiert hätte.
Hier scheint ein argumentativer Mechanismus zu greifen, der aus der Ungleichbehandlung der zwei unterschiedlichen kompositionellen und medialen Formate resultiert, die in der Fabbrica miteinander verbunden sind: Ließe sich der Problematik eines in der Realität nie existenten Klanggewebes nicht das Dilemma eines in Nonos Partitur ebenfalls nie existenten Finales beginnend auf e2 entgegensetzen? Was ist der Unterschied zwischen einer interpretativen Entscheidung für oder wider tatsächlich notierte Tonhöhen und der Abwägung zwischen der Transposition angegebener Stichnoten oder kompletter musikalischer Zusammenhänge auf dem Band? In beiden Fällen handelt es sich um Interpretationsentscheidungen, wobei in ersterem Fall die aktive Partizipation der Interpretierenden erwünscht und sogar für notwendig befunden wird, während mit Blick auf das Tonband diese grundsätzlich ausgeschlossen wird.
Wollte man hier die Position des Komponisten berücksichtigen, ließe sich anführen, dass Nono Interpretierende durchaus als selbständig entscheidende Akteure verstand, wie André Richard, langjähriger Assistent und ehemaliger Leiter des Experimentalstudios des SWR (Freiburg), berichtet:
Lui voleva che l’interprete prendesse sempre decisioni, che non fosse semplicemente uno strumento al servizio del compositore. Voleva una partecipazione attiva per „dare forma“, in tedesco si direbbe gestalten. Lui chiedeva questo all’interprete. E anche se a volte non lo diceva esplicitamente, se qualcuno prendeva l’iniziativa, lui era sempre interessato alle possibilità che potevano nascere.34
Richard beschreibt hier einen für Nonos Arbeit offenbar wesentlichen potenziellen Aktionsraum von Interpretation, der allerdings nicht nur im Widerspruch zur bei Cossettini wie bei Richard vertretenen Aufführungspraxis steht, sondern auch in Carla Henius’ Musikpraxis – ihrem Selbstbild einer primär ausführenden Interpretin gemäß – nur eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben scheint. Möglicherweise bezieht sich die stark generalisierende Aussage Richards auch vor allem auf die 1980er Jahre, jenen Zeitraum, in dem dieser eng mit Nono zusammenarbeitete, und weniger auf die deutlich frühere Kollaboration Nonos mit Carla Henius.
Auch aus der Perspektive der kompositorischen Konzeption ist die Arbeit mit dem historischen Zuspielband nicht unproblematisch, lässt sich doch durch die Henius nachfolgenden Sängerinnen die Verdopplung ein und derselben Stimme durch Live-Interpretin und Tonband nicht mehr herstellen. Cossettini benennt diese Problematik zwar, äußert sich jedoch nicht explizit zu Lösungsansätzen. Im Rahmen seiner Recherche befragt er allerdings sowohl Liliana Poli als auch André Richard, wie mit den beiden Stimmen in der Fabbrica, die nunmehr zwei verschiedenen Interpretinnen zuzuordnen sind, in der Praxis umzugehen sei. Aus Polis Replik lässt sich zwar ein rivalisierendes Verhältnis zwischen Henius und Poli ableiten, nicht jedoch eine greifbare Reflexion zu aufführungspraktischen Problemen der Fabbrica:
Gigi voleva che fossi io a cantare questo pezzo. Molto tempo dopo Nuria [Schoenberg Nono] mi disse che avrebbe voluto fare con me anche il nastro. Certo, poi il nastro è stato fatto con la Henius e nelle esecuzioni voce dal vivo e voce registrata non corrispondevano: la voce della Henius è totalmente diversa dalla mia. Non so cosa sia successo, ma credo che alla fine non si sia trovato molto d’accordo con lei … ho lavorato molto con Nono sull’interpretazione del dialogo con il nastro; poi ho cantato La Fabbrica finché è stato possibile.35
Poli scheint es hier vor allem darum zu gehen, etwaige Zweifel an ihrer Legitimation, die Fabbrica an Henius’ Stelle zu interpretieren, auszuräumen. Damit versteht sie Cossettinis Frage offensichtlich nicht als Ausdruck eines grundsätzlichen Problems, das jede Interpretin seit Henius betrifft, sondern primär als potenzielles Infragestellen ihrer Berechtigung als Sängerin der Fabbrica.
Auch Richard bleibt in dieser Hinsicht eine Antwort schuldig:
Penso che Nono sia stato molto fedele a Carla Henius e a Liliana Poli; tra loro non c’era solo una grandissima stima, ma anche una forte amicizia. Quando ha fatto eseguire l’opera a Susanne Otto, probabilmente non voleva fare troppo concorrenza a queste amiche, ma, come lui stesso ha scritto a Carla, l’opera dev’essere fatta anche con altre cantanti. Ma è proprio questa la vita di un compositore e delle sue opere, no? La musica deve vivere e deve essere interpretata anche da altri. Nono instaurava sempre rapporti umani con gli interpreti delle sue opere, questo era il suo modo di intendere la creazione musicale; e lo ha fatto anche con Susanne che per lui ha cantato altre pagine bellissime. È stato magico, ad esempio, l’Interludio primo nella prima versione del Prometeo, nel 1984 e poi nel 1985. Come descrivere la voce di Susanne? Una voce virginea, di un colore incredibile e una magia grandissima … in questa suggestione è nata la versione per contralto di Susanne.36
Richard bezieht sich in seiner Aussage weniger auf die Problematik von Tonband- und Live-Stimme als auf das Zustandekommen einer weiteren Version der Fabbrica für die Altistin Susanne Otto. Wenn ein Werk überleben solle, so Richards Position, müsse es eben auch von anderen interpretiert werden als von den Uraufführungsinterpretierenden. Auch hier bleibt Cossettinis Frage, die die Adaption der Fabbrica für Susanne Otto eigentlich als Anlass nimmt, grundsätzlich über Anpassungen für die jeweils live singende Interpretin nachzudenken, somit unbeantwortet.37 Trotzdem sind Richards Reminiszenzen durchaus relevant für das Verständnis der besonderen Charakteristik der Zusammenarbeit zwischen Nono und seinen Interpretinnen und Interpreten und können dazu beitragen, die Kooperation mit Carla Henius und damit auch Ursprünge aufführungspraktischer Probleme der Fabbrica illuminata zu erhellen.
Richard spricht von der Bedeutung der „menschlichen Beziehungen“, die Nono zu seinen Interpretierenden aufbaute. Nonos Rolle sei dabei, so Cossettini, nicht nur als Autorität in musikalischer, sondern auch in „ideologischer“ Hinsicht zu beschreiben, als die eines „Guide ins Innere des Werks“: Er habe nicht nur die jeweiligen Vokalpartien für die Interpretinnen festgelegt und den Dialog zwischen Live- und Tonbandstimme vermittelt, sondern sei auch für die Klang- und Bühnenregie verantwortlich gewesen.38 Cossettini spricht hier von einer Tradition des Meister-Schüler-Verhältnisses, das im Zusammenhang mit der oralen Tradierung von aufführungspraktisch relevanten Informationen stehe, welche aus den vorhandenen Materialien allein nicht hervorgingen.
Credo che in mancanza di indicazioni dell’autore si debba risalire alla prassi grazie alle testimonianze di chi ha lavorato con lui alla regia dell’opera; in questo modo non si interrompe quella tradizione, sostanzialmente orale, che si crea con il rapporto maestro/allievo.39
Hier zeichnet sich ein gewisser Widerspruch ab zu Richards oben angeführter Aussage, Nono habe bevorzugt mit Interpretinnen und Interpreten gearbeitet, die die Initiative ergriffen und eigene Entscheidungen getroffen hätten. Cossettini gesteht mit seinem Verweis auf die Notwendigkeit der Beibehaltung des Meister-Schüler-Verhältnisses Interpretierenden deutlich weniger gestalterischen Raum zu als Nono – nach Aussage Richards – in seiner eigenen Praxis. Oder sollte sich diese lediglich auf die Rolle von Interpretierenden beziehen, die mit Nono direkt zusammenarbeiteten, und nicht übertragbar sein auf von Nono unabhängig arbeitende Musikerinnen und Musiker?
Mit Blick auf das Arbeitsverhältnis zwischen Nono und Carla Henius muss tatsächlich von einem als traditionell zu beschreibenden hierarchischen Gefüge gesprochen werden, mit Nono in der Rolle des Meisters, Henius in jener der Schülerin. Die Sängerin selbst schrieb zum Rollenverhältnis in der Zusammenarbeit für die Fabbrica:
Nono hat das Werk zwar mit mir und für mich komponiert, aber diese Arbeit hatte nichts von einer „Widmung“, und sie fand auf der unteren, allerbescheidensten Ebene statt. Stimme und Person stellten sich zur Verfügung wie ein Klumpen Tonerde, aus dem etwas geformt werden sollte. Vertrauen und Unbedingtheit wie im „Käthchen von Heilbronn“ – ein Märchen – gleichviel.40
Scheint auch Henius’ Aussage zunächst eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu suggerieren – das Werk sei mit ihr und für sie geschrieben worden –, so überwiegt doch die Schilderung eines klaren Hierarchiegefälles zugunsten des Komponisten. Die Anspielung an Kleists Käthchen von Heilbronn überhöht geradezu das hier ausgedrückte bedingungslose Vertrauen in die Führung durch den Autor. Basis dieses Vertrauens war für Henius eine tiefe Verehrung des Komponisten, die für sie wiederum mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung stand:
Ein Charakter wie Luigi Nono, der damals noch ein ganz junger Mensch war, schien prädestiniert, die Träume und Hoffnungen unserer Generation zu artikulieren. Der überzeugendste Wesenszug war sein Lebensernst, seine Kraft, Utopien, das bisher Unmögliche, in die Wirklichkeit zu zwingen.41
Henius hebt zudem die „Integrität der Person Luigi Nono“ heraus sowie den „moralische[n] Anspruch und Ernst des Werkes“.42 Damit kommt Nono nicht nur die Rolle des Autors zu, sondern auch die einer moralischen Instanz.
Mag auch die Arbeitsbeziehung zwischen Henius und Nono aus den genannten Gründen und mit offenbarer Zustimmung beider Agierender jenem Meister-Schüler-Verhältnis entsprochen haben, so stellt sich heute die Frage, inwiefern sich diese spezifische Arbeitsweise in der Aufführungspraxis der Fabbrica niederschlägt und ob jene moralische Instanz, mit der Nono offenbar identifiziert wird, nicht auch zu einer Einschränkung des interpretatorischen Aktionsradius führt und folglich mitursächlich ist für das Unbehagen, das sich mit der Idee der Manipulation am Zuspielband verbindet.43
Cossettini spricht von einer in der Hauptsache „oralen Tradition“, die es nicht zu unterbrechen gelte. Bezieht sich diese Aussage auch konkret auf die Klangregie,44 für die deutlich weniger Informationen im Sinne von Aufführungsanweisungen existieren als für die Gesangspartie45 – ein nicht weiter verwunderlicher Umstand, da Nono die Klangregie zu Lebzeiten selbst übernahm und sich daher womöglich nicht veranlasst sah, diese ausführlich zu fixieren –, so überträgt Cossettini diese Art der Tradierung, insbesondere im Umgang mit den genannten Unschärfen, auf die Aufführungspraxis der Fabbrica überhaupt:
La soluzione alle incongruenze che si sono venute a creare dev’essere ricercata fuori dai testi, nella prassi esecutiva che, come sempre, si fonda su una tradizione orale, nel rapporto maestro allievo.46
Die Bedeutung jener oralen Tradition und ihrer Meister-Schüler-Konstellation begründet Cossettini mit dem Fehlen von Informationen für die Musikpraxis. Entscheidend dürfte hier sein, dass Cossettini die Lösungen zu aufführungspraktischen Problemen explizit außerhalb des Texts sucht. Relevant scheinen außerdem jene moralischen Implikationen zu sein, die sowohl Henius als auch Richard hervorheben:
[L]a cosa importante è la mentalità con cui si affronta. È un problema etico-musicologico. Il pericolo più grande è quello di fare un pezzo anodino, banale, finito … chi vuole accostarsi a questa musica deve studiare molto più delle sole note e del nastro. Non si può inquadrare La Fabbrica all’interno di un’estetica o di uno stile definiti. […] Si deve capire come e in che contesto l’opera è stata fatta da Nono.47
Richard spricht sich hier auf den ersten Blick für ein Vorgehen im Sinne einer historisch informierten Aufführungspraxis aus. Die Notwendigkeit, sich mit den Entstehungsumständen der Fabbrica zu beschäftigen, leitet er jedoch von Herausforderungen in der Umsetzung der Komposition ab, die er auf einer „ethisch-musikwissenschaftlichen“ Ebene verortet. Dafür, wie diesen begegnet werde, sei die Mentalität der Interpreten von entscheidender Bedeutung. Offen bleibt, welche Probleme hier genau gemeint sind, sie scheinen jedoch mit der Gefahr einer Banalisierung des Stücks in Verbindung zu stehen, durch welche die Komposition einer Stilistik oder Ästhetik untergeordnet würde. Indem Richard ethisches Verhalten in der Interpretation von La fabbrica illuminata als wesentliche Kategorie zwar benennt, dieses jedoch nicht in konkrete Handlungsoptionen übersetzt, verstärkt er eine Auratisierung der Komposition, deren Ursprung in der durch Henius und andere bezeugten Verehrung Nonos als moralische Instanz liegen mag. Der Schlüssel zu einem adäquaten interpretatorischen Ansatz – die „richtige“ ethische bzw. moralische Haltung – bleibt damit offenbar für Interpretinnen und Interpreten, die nicht mit Nono gearbeitet haben, außer Reichweite. Eine Vermittlung dieser Gehalte kann folgerichtig nicht durch die Aufführungsmaterialien geleistet werden, sondern allein durch jene von Cossettini angeführte orale Tradition, die in Ermangelung der Person Nonos durch Nono nahestehende Personen fortgeführt werden muss.
So wertvoll diese Informationen aus „zweiter Hand“ sein mögen – es stellt sich die Frage, wie weit eine solche Traditionslinie reichen kann. Wer tritt an die Stelle jener, die heute als Zeugen von Nonos Arbeit und seiner Arbeitsweise gelten können? Und müssen nicht bereits diese Informationen „aus zweiter Hand“ im größeren Kontext aller verfügbaren Informationen betrachtet werden? Gehört das „maestro/allievo“-System unabdingbar zur Aufführungspraxis der Fabbrica?
Tatsächlich gibt es auch Stimmen, die alternative Möglichkeiten im Umgang mit den Unschärfen, aber auch den technischen Problemen dieses Stücks sehen. Alvise Vidolin, ebenfalls ehemaliger Assistent Nonos, sagte dazu im Interview mit Cossettini:
[I]n mancanza di indicazioni, deve prevalere la logica musicale che traspare dal nastro e dalla parte musicale da eseguirsi dal vivo. Le registrazioni di esecuzioni originali sono spesso un utile riferimento, anche se non sempre la registrazione della parte elettronica, soprattutto se il sistema di diffusione del suono è multicanale, è un dato oggettivo da prendersi in termini assoluti.48
Die „musikalische Logik“, die sowohl aus dem Tonband als auch aus der Partitur hervorginge, wäre somit zentral für die Interpretation der Fabbrica. Vidolin fokussiert weniger auf die Bedeutung von ethischen Prämissen als auf Sinngehalte des Stücks und sieht dabei vielfältige Wege, diesen gerecht zu werden:
Personalmente ritengo che l’esecuzione musicale debba esplicitare il senso dell’opera, e non c’è mai un unico modo per raggiungere tale obiettivo. Esecutori diversi possono utilizzare differenti strategie, oppure possono esplicitare aspetti diversi dell’opera. L’elettronica digitale può rendere più facile tale lavoro oppure rendere possibili interpretazioni vietate dalla tecnologia analogica del passato.49
Zudem spricht er vom Zusammenwirken zwischen Sängerin und Klangregie als einer Arbeit im Duo, in dem je nach Konstellation unterschiedliche Arbeitsmodi denkbar sind:
Molto dipende dalla cantante, dalla sua esperienza di esecuzione con il nastro magnetico, dal suo grado di approfondimento dell’estetica noniana, dalla sua sensibilità musicale. […] Vista in termini tradizionali, La fabbrica illuminata è un brano per duo in cui uno dei due esecutori, il regista del suono, ha meno gradi di libertà dell’altro. Ma valgono comunque le regole generali dell’esecuzione in duo. Potrebbe verificarsi anche il caso opposto in cui sia il regista del suono a non conoscere affatto come si debba suonare tale nastro e quindi potrebbe essere la cantante a fare le scelte e a dare al regista le indicazioni giuste.50
Vidolin bezieht sich hier offenbar auch auf Konstellationen, in denen keiner der beiden Interpretierenden mit Nono bzw. mit Interpretinnen und Interpreten, die diesem nahestanden, zusammengearbeitet hat. Damit ist für ihn die Fortführung einer oralen Tradition nicht zwingende Voraussetzung, um den Gehalten der Komposition gerecht zu werden. Vielmehr stehen für ihn eine profunde Kenntnis der Nono’schen Ästhetik sowie der Aufführungspraxis der Fabbrica im Fokus – unabhängig von einer quasi genealogischen Legitimation.
Es wird deutlich, dass die aufführungspraktischen Fragestellungen und Probleme in La fabbrica illuminata verschiedene Ebenen berühren. Dazu gehören der Bereich der Vokalästhetik, gesellschaftliche und technische Entwicklungen sowie die Tradierung des Stücks. Letztere scheint von erheblicher Bedeutung dafür zu sein, welche Schwerpunkte bisher in der Findung von Lösungen für die aufgezeigten praxisrelevanten Probleme gesetzt wurden. Auffällig ist hier die kaum hinterfragte Praxis, die Partitur im Moment der klanglichen Realisation im Sinne eines entweder aus den Anweisungen hervorgehenden oder aber aus der Aufführungspraxis abzuleitenden Konzepts zu modifizieren, um Abweichungen auf dem Zuspielband auszugleichen. Parallel dazu werden entsprechende Eingriffe in das Zuspielband gerade von Nono nahestehenden Interpretinnen und Interpreten sowie auch von Verlagsseite abgelehnt bzw. nicht in Betracht gezogen. Neben technischen Herausforderungen scheinen dieser Haltung gerade auch ethisch-moralische Aspekte zugrunde zu liegen, die offenbar mit der Figur Nonos als moralische Instanz und dessen auratischer Verbindung mit dem historischen Zuspielband zusammenhängen. Die von Cossettini propagierte Suche nach Lösungen außerhalb des Texts, das heißt in Fortsetzung des Meister-Schüler-Systems, lässt sich vor diesem Hintergrund in ihren Ursprüngen zwar nachvollziehen. Sie dürfte jedoch durch die daraus resultierende Aufführungstradition, die die benannten Probleme nicht konfliktfrei zu adressieren vermag, sowie durch ihre Bindung an Einzelpersonen auf lange Sicht an Grenzen stoßen.
Operating „Giro del letto“
Sind – wie bei Vidolin – neue Modi der Zusammenarbeit der Interpretierenden innerhalb der Fabbrica denkbar, lassen sich womöglich ebenso Alternativen für den Umgang mit dem Zuspielband vorstellen. Im Gegensatz zu Cossettinis Vorstellung dürfte hier gerade der Text für die Entwicklung von Lösungsansätzen maßgeblich sein, wobei aufführungsrelevante Aussagen von Zeitzeugen eine wichtige Grundlage für interpretatorische Entscheidungen bilden können. Alvise Vidolin spricht im Zusammenhang mit dem Einsatz digitaler Technologien von Möglichkeiten, die die Technik der Zeit nicht erlaubt hätte. Tatsächlich sind heute Eingriffe in das Tonband möglich, die nur einzelne Klangelemente betreffen, die Integrität des Bandes jedoch bewahren. So lässt sich mithilfe der Software iZotope RX5 die Stimme von Carla Henius durch die der jeweiligen Live-Interpretin ersetzen, wobei die übrigen Bandbestandteile weitestgehend unverändert bleiben. Zugleich können Tonhöhenkorrekturen vorgenommen werden, die die Wiedergabe des gesamten Live-Parts in der notierten Lage ermöglichen.
Mit dem Einverständnis des Archivio Luigi Nono Venedig wurde so im Giro del letto überschriebenen zweiten Großabschnitt der Fabbrica sowohl Carla Henius’ Stimme durch die der Autorin ersetzt als auch eine Anpassung der Tonhöhen an die aus der Partitur hervorgehenden Stichnoten vorgenommen.51 Dies geschah unter der Prämisse, dass sowohl die zeitliche Achse als auch alle anderen Elemente des Bandes möglichst unmodifiziert erhalten bleiben sollten. Der genannte Abschnitt bot sich vor allem aufgrund der Präsenz und klaren Identifizierbarkeit von Henius’ Stimme für dieses Experiment an; zudem stellte er mit ca. 5’30’’ Länge eine repräsentative und gleichzeitig überschaubare Größe mit Blick auf die sehr aufwändigen Aufnahme-, Schnitt- und Montagearbeiten dar.52
In einem ersten Schritt wurden die vier Spuren des Zuspielbands im genannten Abschnitt separat analysiert, um die auszutauschenden Passagen mit Henius’ Stimme zu identifizieren. Daraus ergaben sich drei Klangkategorien:
- nur Elektronik (inkl. Chor und aufgenommene Klänge)
- nur Vokalsolistin (Henius)
- Mischklänge (Elektronik und Vokalsolistin überlagert)
Die Klänge von Kategorie 1 konnten in die Laborversion unverändert übernommen werden, während für Kategorien 2 und 3 Eingriffe vorgenommen wurden. Dabei erwies sich die Neuaufnahme und Montage der reinen Vokalklänge – ursprünglich handelte es sich um Klangcollagen mit traditioneller Mehrspuraufnahme – als deutlich weniger aufwändig als die Bearbeitung der Mischklänge. Diese erforderten zum Teil komplexe Spektraloperationen, an deren Ende ein nicht immer von Restklängen der Stimme Henius’ freies Ergebnis stand, denn ein vollständiges Entfernen hätte auch weitere Klangschichten beeinträchtigt. Zentrales Ziel war hier jedoch nicht ein absolutes Entfernen der Stimme von Carla Henius, sondern die Wiederherstellung der Einheit von Band- und Live-Stimme. Diese wird in der Wahrnehmung dadurch erreicht, dass die neu aufgenommene Stimmschicht in ihrer Herkunft als identisch zur Live-Stimme gehört wird, was auch beim Verbleib einzelner Restklänge der historischen Stimme gegeben ist, wenn diese durch die Neuaufnahmen überlagert werden.
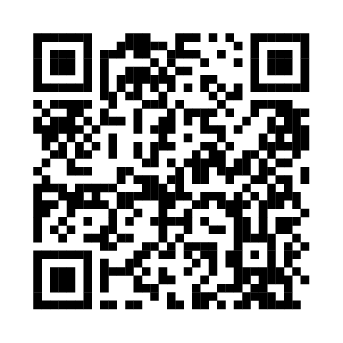
In der SLUB-Mediathek ansehen
https://mediathek.slub-dresden.de/vid90002526.html
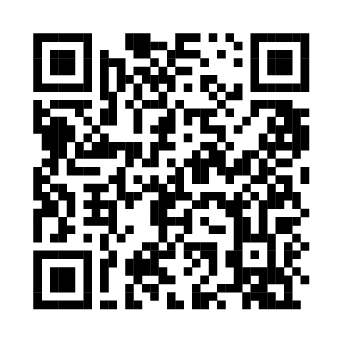
In der SLUB-Mediathek ansehen
https://mediathek.slub-dresden.de/vid90002527.html
Grundlage der Neuaufnahmen bildeten Transkriptionen der verschiedenen Klangschichten jeder einzelnen Spur. Der Prozess des Aufnehmens, Schneidens, Bearbeitens und Montierens zielte hierbei darauf, die Arbeitsweisen von Henius und Nono nachzuvollziehen und angelehnt an Methoden des Reenactment53 zu wiederholen. Das bedeutete, dass die einzelnen Vokal-Samples miteinander sowie auch mit der im ALN lagernden Materialkompilation verglichen wurden. Diese Materialsammlung enthält, soweit erkennbar, sämtliche Vokalmaterialien Henius’, die im Zuspielband in den Abschnitten Giro del letto und dem darauffolgenden Tutta la città verarbeitet wurden. Die Aufnahmen scheinen hier als Rohmaterialien, also ohne Bearbeitung im Tonstudio, vorzuliegen. Damit würden die Hallverhältnisse den jeweiligen Räumen entsprechen, in denen aufgenommen wurde und wären folglich nicht durch Nachbearbeitung zustande gekommen.54 Der Abgleich zwischen Zuspielband und den noch nicht bearbeiteten Materialien aus dem ALN ließ damit Rückschlüsse auf die Entstehung einzelner Samples sowohl in Hinsicht auf die akustischen Verhältnisse der Aufnahmesituation als auch auf ihre Montage zu. Beispielsweise konnte erhellt werden, dass Nono Henius mitunter längere Phrasen singen ließ und Schnitte innerhalb dieser Passagen gesetzt hatte. Die so entstehenden Vokalfragmente wurden anschließend teilweise collagiert.
Aufbauend auf dieser Höranalyse war es möglich, für die Neuaufnahmen die entsprechenden Passagen ebenfalls in schalltoten bzw. überakustischen Räumen aufzunehmen und den Prozess der Montage an Nonos Vorgehen zu orientieren. Das betrifft auch die Nachbearbeitung der Vokal-Samples im Studio (z. B. Filterungen, Stimmverfremdung und Steuerung der Dynamikverläufe), wobei auch hier die jeweiligen technischen Mittel und Prozesse zum Generieren von Klangeffekten nur hörend nachvollzogen werden konnten, da entsprechende Aufzeichnungen von Nono weitestgehend fehlen. Das Ersetzen der solistischen Vokalbestandteile von Carla Henius durch die neu aufgenommenen Samples vollzog damit so nah wie möglich das historische Vorgehen nach. Gleichwohl wurde auf die Verwendung der von Nono eingesetzten analogen Technologien verzichtet, da die Arbeit nicht vordergründig auf die Simulation eines historischen technischen Verfahrens zielte, sondern primär ein zentrales kompositorisches Konzept wieder erfahrbar gemacht werden sollte. Dabei stand zwar das Nachvollziehen, nicht jedoch das exakte Nachstellen von Arbeitsprozessen im Fokus.
Um auch kleinste Inflektionen in der Gestaltung Henius’ zu erfassen, orientierte sich die Sängerin während der Aufnahme per Kopfhörer an deren Einspielung. Damit trug die Neueinspielung der Samples dem Umstand Rechnung, dass die Quellenlage im Fall des historischen Zuspielbands die Unterscheidung zwischen einer von Nono stammenden Vorlage und ihrer Interpretation nicht zulässt: Komposition und Interpretation fallen in eins. Die Neueinspielung strebte daher eine größtmögliche Annäherung an das historische Vorbild an. Einzige Ausnahme bildet hier das Vokaltimbre, das sich grundsätzlich stärker an der in der Partitur wiederholt auftretenden Anweisung non vibrato55 orientierte, als Henius dies offenbar tat.
Tabelle 2: Modifikationen des Tonbands in der Laborversion Giro del letto
| Seite/System | Zeitangabe | Live zu singender Ton | In der Partitur angegebene Stichnote | Zu hören vom Band | Eingriff |
| 5/3 | 7’02’’–7’03’’ | b1 | h1 | ca. gis1–a1 | Mit Erreichen des b1 der Live-Stimme klingt auch b1 auf dem Band. |
| 6/2 | 8’35’’–8’37’’ | g1 | g1 | Etwa ¼-Ton zu tiefes g1 | Band erreicht bei 8’35’’ g1; gesamte Passage ab ca. 8’33’’ wurde angepasst. |
| 6/3 | 8’59’’ | es2 | es2 (nur Kritische Ausgabe) | Etwa ¼-Ton zu tiefes es2 | Einzelton wurde angepasst (ca. 8’55–9’01’’). |
In der parallel erfolgenden Probenarbeit mit dem historischen Zuspielband erwiesen sich die oben benannten Tonhöhen-Diskrepanzen zwischen Zuspielband und Partitur als besonders problematisch. Aus dieser praktischen Erfahrung heraus erfolgte die Entscheidung für die Anpassung der Intonation in den entsprechenden Passagen des Tonbands, allerdings ausschließlich im Abschnitt Giro del letto.56 Damit wurden die neu aufgenommenen Samples erst nachträglich intonatorisch angepasst. Die Transposition betraf in einigen Fällen den gesamten musikalischen Zusammenhang, mit dem Ziel, den ursprünglichen Melodieverlauf beizubehalten (s. Tabelle 2).
Weitere Anpassungen betrafen zwei Passagen mit ambigen Angaben zum Singen mit geschlossenem Mund (bocca chiusa), die die Kritische Ausgabe eindeutig fixiert, ohne jedoch Aufschluss über die Grundlage dieser Fixierung zu geben. Die Neuaufnahme orientierte sich hier an der handschriftlichen Partitur sowie an der Aufnahme mit Carla Henius.57
Laborversion Giro del letto:
https://www.fhnw.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/musik/
hochschule-fuer-musik-klassik/projekte/fokus-darmstadt
Operation
Konzeptualisieren lässt sich das oben beschriebene Vorgehen mithilfe des von Paulo de Assis entwickelten Assemblage-Modells, das im Kontext seiner Arbeit zu Luigi Nonos … sofferte onde serene … (1975–1977) entstand.58 Die darin zentrale Stratifikation der zur Verfügung stehenden Informationen für aufführungspraktische Entscheidungen ermöglicht ein pragmatisches Auffächern der verschiedenen Schichten eines als multiplicity verstandenen musikalischen „Werks“ entlang der Achse Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft.59 Es verdeutlicht so die ständig sich erweiternde Fülle des jene multiplicity konstituierenden Materials sowie die gleichzeitig stets begrenzte Möglichkeit der Einbeziehung sämtlicher existierender Materialien in Interpretation, verstanden als operation.
Musicalworkscease to be conceived as a set of instructions or as an ontologically well-defined structure. They become reservoirs of forces and intensities, dynamic systems characterised by metastability, transductive powers, and unpredictable future reconfigurations. Not only have they been the object of changes in the past (as music history overwhelmingly demonstrates), they will continue to observe mutations and transformations in the future. With a logic of assemblage, music practitioners and theoreticians gain new tools to grasp these changes and take an active part in them. Crucially, the new image ofworkas assemblage has the capacity to include the old image of work within it, as a particular case of less complex combinations of codings and territorialisations. A logic of assemblage has several consequences: the overcoming of unity in favour of multiplicity, of essence in favour of event, of being in favour of becoming, of elusive certainty in favour of informed inconsistency.60
Daraus lässt sich der Imperativ eines interpretatorischen Ansatzes ableiten, immer wieder neue Materialkonstellationen zu schaffen, um das Potenzial einer Partitur auch nur annäherungsweise auszuloten. Aus dem/der Interpretierenden wird the operator:
Instead of performances of musical works, this new mode of performance offers problematisations of such works, exposing some of the tensions and potential inconsistencies latent in them. Beyond representing a work, the performances made by an operator investigate how those works work […]. Where an interpreter aims at reproducing the musical work […], an operator aims at creating a performative situation that can be regarded as a critical study of that work through the means of performance itself. […] The specificity of the operator is that he or she works beyond conventional notions of performance, execution, interpretation, and composition, which all merge together in the operator’s daily practice and in his or her presence onstage. This practice and presence constitute a critical act against the commonplace and the clichéd, and generate an aesthetico-epistemic space of experimentation, overcoming both interpretation and representation. […] The experimental performance practice of a musical operator permits the emergence of other realities, fostering an image of the musical work as a multiplicity, establishing a working methodology that brings together research and artistic skills, and arguing for a new ethics of performance and music reception.61
Die hier beschriebenen Charakteristika der operation lassen sich in der Arbeit an Giro del letto unschwer nachvollziehen: In der partiellen Neuaufnahme des Zuspielbands verschwimmen die Grenzen zwischen Interpretation und Komposition, in der Regel akzeptierte und stabilisierte Grenzen interpretatorischen Handelns werden klar überschritten. Dabei ließe sich gerade mit Blick auf die Neuaufnahme von einer extrem „werktreuen“ Interpretation sprechen – vorausgesetzt das „Werk“ wäre nicht primär durch ein fixiertes Set von Materialien und Informationen definiert. Die im vorliegenden Fall gewählte Materialkonstellation priorisiert die für Nonos Komposition offenbar wesentliche konzeptuelle Idee der Einheit von Live- und Bandstimme, die sich in Abwesenheit der Uraufführungsinterpretin Carla Henius ausschließlich durch eine Neuaufnahme des Zuspielbands „werktreu“ wiedergeben lässt.
Rezeption
Aus den beschriebenen Eingriffen am Band und aus deren Erprobung in der Praxis resultierten Erkenntnisse sowohl auf der Ebene der Aufführungspraxis als auch der Rezeption. Bereits in der Probenarbeit wurde der Effekt deutlich, den Henius kurz nach der Uraufführung gegenüber Adorno beschrieben hatte: „Es war ungefähr so, als würdest du etwas sagen und hörtest gleichzeitig all deine Gedanken.“62 Tatsächlich ergab sich für die Interpretin im Gegensatz zur Arbeit mit dem historischen Band ein grundsätzlich anderer Bezugspunkt: Während die sowohl zeitliche als auch persönliche Distanz zum historischen Zuspielband vor allem zu einer Auseinandersetzung mit Blick auf die eigene Positionierung zu den vokalästhetischen, technischen und musikalischen Gegebenheiten des Bandes führte sowie Fragen der zeitlichen Koordination adressierte, kam es gerade durch den intensiven analytischen und kreativen Prozess in der Vorbereitung und Durchführung der Neuaufnahmen zu einer stärkeren Identifikation mit dem Resultat dieser Arbeit. Es ließe sich also von einer Perspektivverschiebung sprechen: weg von der Außensicht und hin zu einer Innensicht auf das Band und die Arbeit damit. Darüber hinaus eröffnete die vertiefte Beschäftigung mit dem historischen Zuspielband gerade durch den physischen Prozess des vokalen Nachvollziehens von Henius’ Interpretation einen alternativen Zugang zur Auseinandersetzung mit den Klangmaterialien und ihrer Komposition auf dem Band. Die hier generierten Erkenntnisse können damit als embodied beschrieben werden. Das Konzept des embodiment unterstreicht die unmittelbare Beeinflussung der Kognition durch den Körper und stellt eine wesentliche Prämisse künstlerischer Forschung dar.63 Basierend auf dem Modell der distributed cognition werden so kontextualisierende Prozesse zwischen „brains, bodies and things“64 als wesentliche Grundlage des Denkens und Erfassens von Zusammenhängen verstanden. Durch den besonderen Fokus auf das physische Nachvollziehen der historischen Vokal-Samples und ihres Entstehungsprozesses kommt es hier zu einer „Intensivierung des Wissens“.65
Die Aufführung66 der Laborversion Giro del letto führte außerdem zu Erkenntnissen mit Blick auf die Rezeptionsebene, die darauf schließen lassen, dass die Wahrnehmung des Stücks in der Tat deutlich durch den Umstand beeinflusst wurde, dass Live- und Tonbandstimme von derselben Person stammten. Unter anderem wurde eine Intensivierung im Erleben des performativen Ereignisses festgestellt, das sich u. a. aus der häufig nicht eindeutig zuzuordnenden Quelle der jeweils hörbaren Vokalklänge zu ergeben schien. Zudem veränderte sich offenbar die Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Live- und Tonbandkomponente mit Blick auf die Dauernrelation. So weist die Fabbrica ein relativ starkes Ungleichgewicht zwischen der Laufzeit des Tonbands von ca. 14 Minuten und der Gesamtdauer des Live-Gesangs von ca. 6’40’’ auf. Von Letzterer entfallen etwa 2’40’’ auf das Finale des Stücks, in dem die Interpretin unbegleitet singt. Das bedeutet, dass innerhalb des 14-minütigen Tonbands die Live-Sängerin, verteilt über die Gesamtdauer des Bandes, nur vier Minuten zu hören ist. Dieses Ungleichgewicht führt nicht zuletzt zu aufführungspraktischen Fragestellungen die Haltung und Rolle der Sängerin als Interpretin betreffend.
Bereits Henius hatte die ungewöhnliche Situation der Sängerin in der Fabbrica reflektiert. In ihren Arbeitsnotizen schreibt sie im August 1964, und damit kurz vor der Uraufführung:
Was mir auffällt: es ist nie von „Interpretation“ die Rede. […] „Identifikation“ wie es bei der „Intolleranza“ natürlich und selbstverständlich war, soll in diesem Stück nur aufgesplittert in einzelnen Momenten wahrzunehmen sein. Wenn ich mich in dieser letzten Arbeitsphase anstrenge, klanglich und technisch so differenziert und genau wie möglich Gigis Vorstellungen vom Stück zu erreichen, dann ergeben sich zwar Ausdrucksvarianten wie Protest, Leiden oder eine Art visionärer Freude – aber sie programmieren nicht den Verlauf, sondern sind konkrete Zustände, übersetzt in musikalische Realität. Mein Bewusstsein spielt also gar keine Rolle.67
Tatsächlich ließe sich bei den genannten Dauernverhältnissen eher von einer Tonbandkomposition mit obligater Gesangsstimme sprechen als von einer Komposition für Sopran und Zuspielband. Immer wieder läuft das Band für längere Passagen ohne die Sängerin; an zwei Stellen beträgt die Dauer dieser Band-Soli ca. drei Minuten. Hat die Live-Interpretin hier eher die Funktion, die Zuhörenden auf die Tonbandkomposition zu fokussieren?68 Warum verstand Henius das Stück trotzdem im Sinne eines Schauspielmonologs?69 Eine explizite Rolle im Sinne einer durch sie kommunizierten Aussage oder Haltung übernimmt die Sängerin eigentlich erst im Vokalsolo des Finales.70 Der Einsatz der solistischen menschlichen Stimme am Ende des Stücks wird dabei häufig als Ausdruck der Hoffnung verstanden, der Mensch bzw. das „Menschliche“ würde über das „Unmenschliche“ der Fabrik, also des Maschinalen, siegen:
Geht man davon aus, daß die Elektronik in diesem Stück eine Allegorie der Technik ist, die unverfremdete, reine menschliche Stimme, [sic] die der menschlichen Gesellschaft, so bedeutet hier die Ewigkeit die Befreiung von der Technik als Ausdruck des Irdisch-Vergänglichen […], also ewiges Leben nach dem Tod. Ein religiöses Bild! […] Die menschliche Stimme tritt in Vordergrund als Ausdruck des befreiten Menschen, einer befreiten Gesellschaft.71
Die Disparatheit der Rolle der Interpretin – nicht verstanden als Gestaltungsmittel zur Darstellung der Vielschichtigkeit bzw. Zerrissenheit des Fabrikarbeiterindividuums, sondern im Sinne einer dramaturgischen Dysfunktionalität – ergibt sich jedoch vor allem, wenn in der Wahrnehmung die Trennung des Gehörten in Live-Interpretation einerseits und Zuspielband andererseits dominiert. Betrachtet man jedoch nicht das Verhältnis zwischen Live- und Fixkomponente, sondern zwischen der solistischen Stimme (unabhängig davon, ob diese vom Band oder live erklingt) und den übrigen Klängen, ergibt sich hier an anderes Bild.
Auf dem Zuspielband erscheint die Stimme der Sängerin erstmals nach dem großen Crescendo (Colata) ab ca. 6’44’’, also quasi gleichzeitig mit dem Einsatz der Live-Stimme in Giro del letto. Von dort an ist sie bis zum Ende des Stücks durchgehend präsent – wenn auch im Verhältnis zu anderen Bandbestandteilen in divergierender Prägnanz. Versteht man also Band- und Live-Stimme als Einheit, die sich jedoch in zwei verschiedenen Darbietungsmodi präsentiert, dürfte sich der Fokus weniger auf die Relation zwischen Band (Gesamtdauer 14’) und Stimme (Gesamtdauer 6’40’’) richten, sondern verstärkt auf das Verhältnis zwischen Klängen ohne solistische Stimme (Gesamtdauer 10’10’’) und dem sowohl live als auch vom Band zu hörenden Sologesang (Gesamtdauer 10’30’’). Richtet sich die Aufmerksamkeit also nicht auf die Balance zwischen Live-Interpretation und Zuspielband, sondern auf jene zwischen solistischer Stimme und übrigen Klängen, ergibt sich plötzlich ein deutlich ausgewogeneres Verhältnis. Auf welches der beiden Verhältnisse sich die Hörenden konzentrieren, dürfte allerdings davon abhängig sein, ob mit dem historischen Band oder mit einem von der jeweiligen Sängerin neu aufgenommenen Band gearbeitet wird.
Vor diesem Hintergrund lässt sich nachvollziehen, weshalb bei der Aufführung mit aktualisiertem Zuspielband die Identität von Live- und Tonbandstimme deutlichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Gehörten hatte: Die klar identifizierbare und der Live-Interpretin zuzuordnende Stimme vom Band wurde hier als Teil der solistischen Performance wahrgenommen, auch wenn diese als im Moment stattfindender interpretatorischer Akt tatsächlich auf die wenigen Minuten des Live-Gesangs beschränkt war. Damit wurde zudem ein Aspekt entschärft, der den relativ geringen interpretatorischen Spielraum betrifft, der bereits bei Henius anklingt: Der Verlauf der Aufführung ist maßgeblich durch das Zuspielband festgelegt und wird von der Live-Performance nicht beeinflusst. Jedoch scheint sich die Wahrnehmung im Sinne einer im Moment entstehenden Interpretation durch den, wenn auch geringen, Anteil der Live-Interpretation auf die Gesamtheit des solistischen Gesangs zu übertragen – vorausgesetzt, dieser stammt von derselben Sängerin. Carla Henius’ Verständnis des Stücks als Schauspielmonolog wird damit ebenfalls nachvollziehbar, indem beide Stimmen als eine auf zwei mediale Ebenen verteilte Entität begriffen werden, verklammert durch die eine Sängerinnen-Persona.
Und noch einen weiteren Aspekt berührt die Frage nach der Wahrnehmung der Stimme: jenen der Körperlichkeit. Bringt Stimmlichkeit grundsätzlich auch immer Körperlichkeit hervor, wie Erika Fischer-Lichte schreibt,72 verweist also die Stimme auf den Körper, der sie hervorbringt, so dürfte aus der Präsenz der Sängerin und ihrer erklingenden Stimme – unabhängig davon ob live oder vom Band – eine kontinuierliche Bezugnahme zwischen beiden resultieren. Es ist anzunehmen, dass auch dies die Wahrnehmung der Sängerin als in einer Rolle Agierende unterstützt, denn die Interpretin stellt mit ihrer Präsenz die Verbindung zur Stimme in beiden medialen Erscheinungsformen dar. Wenn Irene Lehmann also davon schreibt, Band- und Live-Stimme wären als Mittel zur Darstellung der Zerrissenheit der Arbeiterin zu verstehen,73 die durch die Solistin verkörpert wird, so ließe sich ebenso sagen, dass die Körperlichkeit der Sängerin in ihrem Wirken auf die Wahrnehmung der beiden Stimmebenen wiederum im Sinne der Integrität dieser Figur wirkt. Damit wäre hier vielmehr von einem Oszillieren zwischen Integrität und Nicht-Integrität zu sprechen, das sich, wie oben dargestellt, auch auf der kompositorischen Ebene – gerade in Giro del letto – nachvollziehen lässt. Folglich kommt der physischen Präsenz der Sängerin auch dann Bedeutung zu, wenn sie nicht singt. Allerdings würde die Stimme des historischen Zuspielbands in erster Linie auf die Körperlichkeit Carla Henius’ verweisen und folglich in Abgrenzung zur Live-Stimme und der damit verbundenen Körperlichkeit der jeweiligen Sängerin stehen. Deren Präsenz hätte in Bezug auf die Tonbandstimme kaum noch eine Funktion als Bezugspunkt; vielmehr dürfte sie als separate Bedeutungsschicht aufgefasst werden. Dass die Unverbundenheit zwischen körperloser Stimme – bzw. auf einen nicht anwesenden Körper verweisender Stimme – und der Körperlichkeit der jeweiligen Sängerin in der Aufführungspraxis der Fabbrica durchaus als problematisch empfunden wird, mag sich in dem Umstand spiegeln, dass in Aufführungen innerhalb der entsprechenden Abschnitte mitunter ein Dimmen des Bühnenlichts vorgenommen wird, das den Effekt hat, die Präsenz der Live-Interpretin abzuschwächen.74
Damit erweist sich das Experiment zum Abschnitt Giro del letto auch aus der Rezeptionsperspektive als bedeutsam. Die Rückmeldungen von Zuhörerinnen und Zuhörern der Aufführung mit dem modifizierten Band weisen darauf hin, dass sich die Wahrnehmung von Live- und Tonbandstimme als zur physisch präsenten Sängerin gehörig auf das Verständnis der Relation zwischen fixer Komponente und Live-Interpretin auswirkt. Dabei kann die Tonbandstimme in ihrer möglichen Zuordnung sowohl zum Zuspielband (als ein Element dessen) als auch zur Live-Interpretin zwischen diesen beiden medialen Dimensionen als Mittlerin verstanden werden. Dieser Effekt wird durch die identische Herkunft beider Stimmen begünstigt. Die mitunter durch ästhetische Differenzen, aber auch aufgrund des Ungleichgewichts der Dauern problematische Verbindung von Zuspielband und Live-Sängerin erweist sich so offenbar für das Publikum als sinnhaft nachvollziehbarer: Die Vermittlung durch die solistische Stimme unterstützt dabei die Wahrnehmung der beiden Komponenten weniger im Sinne zweier aufeinandertreffender, medial verschiedener Werkbestandteile, sondern vielmehr als kompositorische und dramaturgische Einheit. Physische Präsenz der Sängerin und körperlose Stimme sowie live erklingender Gesang erscheinen dabei als performative Entität, wobei die sich hierin verdichtende Figur der Stahlwerkarbeiterin zwischen Einheit und Aufspaltung oszilliert.
Konklusion 1
Am Beispiel der Fabbrica illuminata wird deutlich, dass die Arbeit mit historischen fixed media u. a. auf technischer, ästhetischer, gesellschaftspolitischer und konzeptueller Ebene Fragen aufwirft. Gerade in der vorliegenden Komposition berühren diese zentrale Aspekte der Aufführungspraxis, die sich offenbar im Wesentlichen auf ein System oraler Tradierung stützt. Mit diesem scheinen sowohl ein Defizit verfügbarer aufführungspraktischer Informationen von Seiten Nonos ausgeglichen als auch über die musikalische Realisierung hinausgehende Werte ethisch-moralischer Natur vermittelt werden zu sollen. Aufgrund der aus dem sogenannten „maestro/allievo“-System resultierenden Bindung an Einzelpersonen erweist sich dieser sehr einseitig zu Ungunsten der Textarbeit ausgerichtete Ansatz gerade im Kontext aufführungspraktischer Fragestellungen als problematisch. Eine proaktive Alternative stellt hier ein kritischer Umgang der Interpretierenden mit sämtlichen verfügbaren Quellen dar, wobei ein textkritisches Vorgehen sowohl auf die Partitur als auch auf das Zuspielband anwendbar ist. Beide werden hier in ihrem Potenzial wahrgenommen, das sich je nach Interpretation in unterschiedlicher Weise manifestieren kann.
Gleichwohl führt das hier beschriebene Verfahren nicht zu konfliktfreien Lösungen mit Blick auf die identifizierten aufführungspraktischen Probleme in La fabbrica illuminata. Aus diesem Befund leitet sich die Übertragung von Fragestellungen aus der Arbeit an der Fabbrica in den Kontext musikalischer Produktion ab. Diese überschreitet klar den bei de Assis implizierten Rahmen von künstlerischer Forschung, indem nicht mehr die musikpraktische Studie Fabbrica selbst den Verhandlungsraum der aufgeworfenen Fragen darstellt, sondern eine neu entstehende Komposition. De Assis’ Modell wird damit anhand von Andreas Eduardo Franks Restore Factory Defaults um den Aspekt der Produktion erweitert.
1 Der Beitrag ist eine erweiterte Version des gleichnamigen Kapitels aus Anne-May Krügers Dissertationsschrift Musik über Stimmen. Vokalinterpretinnen und -interpreten der 1950er und 60er Jahre im Fokus hybrider Forschung, Hofheim 2022.
2 „Ein Tonband elektronischer Musik ist, wenn es produziert wird, nicht wirklich definitiv fixiert. […] Die Dynamik und der Charakter meiner Musik, auch der elektronischen, hängen von den Bedingungen während ihrer Aufführung, von den Reaktionen der Zuhörer und der Interpreten ab, und ich selbst muss darauf reagieren.“ Luigi Nono in: Sigrid Neef und Luigi Nono, Intervista di Sigrid Neef (1974), in: Luigi Nono. Scritti e colloqui, hrsg. von Angela Ida de Benedictis und Veniero Rizzardi, Mailand 2001, Bd. 2, S. 191–200, hier S. 193. Übersetzung durch die Autorin.
3 Vgl. Nina Jozefowicz, Das alltägliche Drama. Luigi Nonos Vokalkompositionen mit Tonband La fabbrica illuminata und A floresta é jovem e cheja de vida im Kontext der unvollendeten Musiktheaterprojekte, Hofheim 2012.
4 Vgl. u. a. Luca Cossettini, Tracce di un contrappunto a due dimensioni. Testi e registrazioni sonore nella musica ellettronica di Luigi Nono. Note per una critica delle fonti, in: Luigi Nono: studi, edizione, testimonianze (= Quaderni del Laboratorio MIRAGE), hrsg. von Luca Cossettini, Lucca 2010, S. 3–66; Ernst Flammer, Politisch engagierte Musik als kompositorisches Problem, dargestellt am Beispiel von Luigi Nono und Hans Werner Henze, Baden-Baden 1981, S. 19–106; Hartmut Möller, Nonos ‚La fabbrica illuminata‘ heute. Veränderte Hörwinkel, in: Die Musik Luigi Nonos, hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien 1991, S. 205–256; Jozefowicz, Das alltägliche Drama; Bernd Riede, Hörpartituren zu Luigi Nonos Werken mit Tonband, in: Klang und Wahrnehmung. Komponist – Interpret – Hörer, hrsg. vom Institut für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Mainz 2011, S. 194–197; ders., Luigi Nonos Kompositionen mit Tonband. Ästhetik des musikalischen Materials – Werkanalysen – Werkverzeichnis (= Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten, Bd. 28), München/Salzburg 1986, insb. S. 30–47; Ivanka Stoïanova, Luigi Nonos Vokalwerke der fünfziger und sechziger Jahre, in: Die Musik Luigi Nonos, hrsg. von Otto Kolleritsch, Wien 1991, S. 180–204.
5 Irene Lehmann problematisiert zwar die Aufführungspraxis von La fabbrica illuminata, allerdings setzt sie den Schwerpunkt auf Fragen der Theatralität und berücksichtigt musikinterpretatorische Aspekte lediglich im Hinblick auf daraus zu schließende Indizien für die Sinnhaftigkeit stärker performativ ausgerichteter Umsetzungskonzepte. Die sich aus den Aufführungsmaterialien auf musikalischer Ebene ergebenden Spannungen gerade im Zusammenspiel von historischem Tonband und Live-Gesang werden dabei nicht kommentiert. Vgl. Irene Lehmann, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater. Politik und Ästhetik in Luigi Nonos musiktheatralen Arbeiten zwischen 1960 und 1975, Hofheim 2019, S. 197–230.
6 Luigi Nono, La fabbrica illuminata, Aufführungspartitur, Handschrift, CH-Bps, Sammlung Paul Sacher.
7 CD 078, ALN, Track 1: Carla prove voce (indicazioni di Nono), Track 2: Carla prove voce (indicazioni di Nono), Track 3: L. Nono copia stereo 7 1/2 (19cm/s).
8 Luigi Nono, La fabbrica illuminata per soprano e nastro magnetico a quattro piste (1964), Kritische Ausgabe, hrsg. von Luca Cossettini, Mailand 2010.
9 Eine umfassende Auswertung der genannten Untersuchungen findet sich auch in weiteren Publikationen Cossettinis. Vgl. z. B. Luigi Nono: studi, edizione, testimonianze (= Quaderni del laboratorio MIRAGE), hrsg. von Luca Cossettini, Lucca 2010.
10 Als Interpretierende werden hier sowohl die Sängerin als auch der Klangregisseur bzw. die Klangregisseurin verstanden.
11 Luca Cossettini in: Nono, La fabbrica illuminata, Kritische Ausgabe, S. XXII.
12 Auf die Problematik von Veränderungen durch fehlerhaftes Überspielen der Bänder bzw. durch langjährige Lagerung wird an späterer Stelle eingegangen.
13 Björn Gottstein spricht von der „Notwendigkeit der Aktualisierung […], die nur der Interpret leisten kann“. Björn Gottstein, Imperativ & Ungehorsam. Über mögliche Strategien der Interpretation zeitgenössischer Musik, in: Macht Ohnmacht Zufall. Aufführungspraxis, Interpretation und Rezeption im Musiktheater, hrsg. von Christa Brüstle, Clemens Risi und Stephanie Schwarz, Berlin 2011, S. 123–136, hier S. 130. Als unabdingbaren Teil der Existenzbedingungen des musikalischen Kunstwerks beschreibt Hermann Danuser die „historische Wandlungsfähigkeit“. Vgl. Hermann Danuser, Art. Vortrag, Historische Etappen, 19. Jahrhundert, Auktoriale, allgemeine und besondere Vortragslehre in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, 2016ff., zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016 unter https://www.mgg-online.com/mgg/stable/392693, zuletzt eingesehen am 22.09.2021.
14 Guy E. Garnett, The Aesthetics of Interactive Computer Music, in: Computer Music Journal 25/1 (2001), S. 21–33, hier S. 29.
15 Die Problematik dieser starken Verankerung in den gesellschaftspolitischen Kontext seiner Entstehungszeit betrifft selbstverständlich sowohl die Live- als auch die Tonbandkomponente der Komposition. Allerdings stellt gerade das Tonband mit seinen zwar manipulierten, jedoch auch auf eine reale auditive Umwelt der Vergangenheit verweisenden Klängen ein historisches Dokument dar, dessen Inhalte heute anders rezipiert werden dürften als vor 50 Jahren. Hartmut Möller argumentiert allerdings dafür, dass La fabbrica illuminata womöglich schon zu ihrer Entstehungszeit auf einer überholten Vorstellung des Verhältnisses von Arbeitern zur Technisierung basierte. Vgl. Möller, Nonos ‚La fabbrica illuminata‘ heute.
16 Marino Zuccheri (1923–2005) war von entscheidender Bedeutung für die Entstehung bzw. Realisierung zahlreicher elektroakustischer Kompositionen u. a. von Luigi Nono, Bruno Maderna, Luciano Berio, John Cage, Karlheinz Stockhausen und Henri Pousseur.
17 „Tecnica di particolare registrazione di Marino per evitare la diversità tra nastro registrato e voce dal vivo (non amplificata): non v’era né il Dolby – né il Digital System.“ Luigi Nono, Per Marino Zuccheri, in: Luigi Nono. Scritti e colloqui, hrsg. von Angela Ida de Benedictis und Veniero Rizzardi, Mailand 2001, Bd. 1, S. 406–413, hier S. 410.
18 Carla Henius, Über Luigi Nonos ‚Intolleranza‘ und ‚La fabbrica illuminata‘. Notizen zur Aufführungsgeschichte, in: dies., Schnebel, Nono, Schönberg oder Die wirkliche und die erdachte Musik, Hamburg 1993, S. 126–136, hier S. 129.
19 Vgl. auch Mitschnitt der Aufführung von La fabbrica illuminata, Abschnitt Giro del letto, am 10.05.2017 im Neuestheater Dornach mit der Autorin (Mezzosopran) und Holger Stenschke (Audiodesign): https://youtu.be/fu28JmhQdm4, zuletzt eingesehen am 25.03.2020.
20 Der Begriff „Stichnote“ bezeichnet Tonhöhenangaben, die in der schematischen Darstellung des Zuspielbands in der Partitur kenntlich gemacht sind. Diese treten ausschließlich im Abschnitt Giro del letto und direkt vor dem Finale auf. Sie entsprechen der Ausnotation von Schlüsselpassagen auf dem Band, von denen die Sängerin ihren Ton abzunehmen hat. Überwiegend handelt es sich dabei um Unisoni (Stichnote = live zu singende Note).
21 Das fehlerhafte Überspielen des Bands R1, d. h. das durch ein falsch kalibriertes Abspielgerät zu langsame Abspielen des Zuspielbands, resultierte in Abweichungen sowohl von den in der Partitur angegebenen zeitlichen Cues, als auch der Tonhöhen. Jedoch erscheint auch in der kritischen Ausgabe die Darstellung dieser Problematik widersprüchlich, wenn einerseits festgestellt wird: „The velocity discrepancy of 1.6% is instead the same in the tapes between R1 and R2“ (Kritische Ausgabe, S. XXIV, FN 23), andererseits in der Auflistung der Quellen zum Tonband R2 festgehalten wird: „This tape seems to have been recorded at 1.6% slower velocity than R1.“ Vgl. auch Kritische Ausgabe, S. XXX.
22 Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich die Analyse auf die Faksimile-Partitur, die 1967 bei Ricordi Mailand erschienen ist.
23 Vgl. Luca Cossettini in der Einleitung zu Nono, La fabbrica illuminata, Kritische Ausgabe, S. XXIII.
24 Ebd.
25 Vgl. Stoïanova, Luigi Nonos Vokalwerke der fünfziger und sechziger Jahre, S. 182ff. Jürg Stenzl beschreibt die Arbeit mit Klangfarben und unterschiedlichen Dichteverhältnissen zudem für La terra e la compagna (1957) für Sopran- und Tenorsoli, Chor und Instrumente. Auch hier lässt sich die Auffächerung der Stimmen vom einstimmigen bis zum 15-stimmigen Satz beobachten. Vgl. Jürg Stenzl, Luigi Nono und Cesare Pavese, in: Luigi Nono. Texte. Studien zu seiner Musik, hrsg. von Jürg Stenzl, Zürich 1975, S. 409–433, hier S. 423ff.
26 „[Ich] stelle mir eine Art Joyce’schen ‚innern Monolog‘ vor – man spricht und denkt gleichzeitig ganz Verschiedenes.“ Carla Henius, Arbeitsnotizen, Juni 1964, in: dies., Carla Carissima: Carla Henius und Luigi Nono. Briefe, Tagebücher, Notizen, Hamburg 1995, S. 28–32, hier S. 29.
27 Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit Nonos Einsatz von Unisoni in „Ha venido“ Canciones para Silvia und Intolleranza 1960 siehe: Krüger, Musik über Stimmen, S. 216ff.
28 Vgl. Jozefowicz, Das alltägliche Drama, S. 65.
29 Jozefowicz, Das alltägliche Drama, S. 87.
30 Luca Cossettini, in: Nono, La fabbrica illuminata, Kritische Ausgabe, S. 7.
31 Cossettini irrt, wenn er schreibt, Carla Henius habe die Fabbrica nur wenig mehr als ein Jahr gesungen; danach sei Liliana Poli die „Stimme“ der Fabbrica geworden: „[D]opo Carla Henius che interpretò l’opera per poco più di un anno, è stata ‚la voce‘ della Fabbrica illuminata.“ In: Liliana Poli und Luca Cossettini, Colloquio con Liliana Poli su ‚La fabbrica illuminata‘ e ‚Y entoces comprendió‘ (2006), in: Luigi Nono: studi, edizione, testimonianze, S. 230–239, hier S. 231. Tatsächlich finden sich in Henius’ Programmnachweisen Vermerke über Fabbrica-Aufführungen bis zum Ende der 1980er Jahre. Möglicherweise ist Cossettinis Aussage dahingehend zu verstehen, dass Henius die Komposition in der Folge nicht mehr mit Nono als Klangregisseur aufführte.
32 Hermann Danuser argumentiert für das Verständnis von elektronischer Musik als Text, „wo der Klangtext ohne Referenz auf einen interpretationsbedürftigen Partiturtext das Fundament der Musik ausmacht. Der Klangtext ist hier, sofern er vom Komponisten im Studio auf Band realisiert wurde, nicht musikalische Interpretation, sondern selbst primäres und einziges Kunstobjekt“. Hermann Danuser, Der Text und die Texte. Über Singularisierung und Pluralisierung einer Kategorie, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß Freiburg „Musik als Text“ 1993, hrsg. von Hermann Danuser und Tobias Plebuch, Kassel 1998, S. 38–44, hier S. 44.
33 „Die ‚falsche‘ Note ist nur eine der Chorstimmen, welche jedoch nicht separat bearbeitet werden können. Ebenso unmöglich ist es, zu entscheiden, wo eine Transposition beginnen sollte – müsste diese sich hier beispielsweise auf die drei transkribierten Noten beschränken oder wäre es notwendig, den gesamten Choral zu verändern? Dazu ergeben sich häufig unüberwindbare Schwierigkeiten, die die Aufteilung des Kontinuums des Klanggewebes angehen. […] Andererseits könnten sich auch starke und begründete Zweifel über die Legitimation einer solchen Operation auftun: Indem das Band basierend auf seiner Deskription in der Partitur, nicht einer Präskription, als inkorrekt verstanden wird, entstünde auf der Grundlage dieser Annahme durch die Korrektur ein Band, das so nie existiert hat.“ Cossettini, Tracce di un contrappunto a due dimensioni, S. 49f. Übersetzung durch die Autorin.
34 „Er wollte immer, dass der Interpret Entscheidungen trifft, dass er nicht einfach ein Instrument im Dienste des Komponisten sei. Er wollte eine aktive Partizipation, um ‚Form zu geben‘, auf Deutsch würde man gestalten sagen. Das verlangte er vom Interpreten. Und auch wenn er es manchmal nicht explizit sagte – wenn jemand die Initiative ergriff, war er immer interessiert an den Möglichkeiten, die daraus erwachsen konnten.“ André Richard in: Colloquio con André Richard su ‚La fabbrica illuminata‘ (2006), in: Luigi Nono: studi, edizione, testimonianze, S. 241–249, hier S. 244. Übersetzung durch die Autorin.
35 „Gigi wollte, dass ich dieses Stück singe. Sehr viel später sagte mir Nuria [Schoenberg Nono], dass er auch das Band mit mir hätte machen wollen. Sicher, das Band ist dann mit Henius gemacht worden und in den Aufführungen stimmten die Live- und die Band-Stimme nicht überein: Die Stimme der Henius ist ganz anders als meine. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich denke, dass er am Ende nicht sehr mit ihr einverstanden war … Ich habe viel mit Nono an der Interpretation des Dialogs mit dem Band gearbeitet; dann habe ich La Fabbrica gesungen, solange es möglich war.“ Liliana Poli in: Colloquio con Liliana Poli, S. 232. Übersetzung durch die Autorin.
36 „Ich denke, dass Nono Carla Henius und Liliana Poli sehr treu war; zwischen ihnen herrschte nicht nur eine große Wertschätzung, sondern auch eine enge Freundschaft. Als er das Stück von Susanne Otto singen ließ, wollte er den beiden Freundinnen vermutlich nicht zu viel Konkurrenz verursachen. Aber wie er selbst Carla schrieb: Das Stück muss auch von anderen Sängerinnen gesungen werden. Aber das ist eben wahrscheinlich das Leben eines Komponisten und seiner Werke, oder? Die Musik muss leben und muss auch von anderen interpretiert werden. Nono baute zu den Interpreten seiner Werke immer menschliche Beziehungen auf. Das war seine Art, eine musikalische Kreation anzugehen. Und das hat er auch mit Susanne Otto getan, die weitere wunderschöne Stücke für ihn gesungen hat. Es war magisch. Z. B. das Interludio primo in der ersten Version des Prometeo 1984 und dann 1985. Wie kann man die Stimme Susannes beschreiben? Eine jungfräuliche Stimme mit einer unglaublichen Farbe und einer ungeheuer großen Magie … Aus diesem Empfinden ist die Alt-Version für Susanne entstanden.“ André Richard in: Colloquio con André Richard, S. 244. Übersetzung durch die Autorin.
37 Nono hatte die Komposition für die Altistin Susanne Otto an mehreren Stellen nach unten transponiert. Cossettini fragt in diesem Zusammenhang: „War das ein Einzelfall, oder muss das Werk in einem bestimmten Sinn jedes Mal auf die Interpretin zugeschnitten werden?“ („Questo è stato un caso isolato o l’opera, in un certo senso, deve essere ‚ricucita‘ ogni volta sull’interprete?“) Ebd. Übersetzung durch die Autorin.
38 „Nono lavorava a stretto contatto con gli interpreti e gli guidava, anche ideologicamente ‚dentro‘ l’opera. Mi sembra di capire che il suo fosse un ruolo molto complesso: curava la regia del suono, definiva le parti soliste con le stesse interpreti, le guidava nel dialogo nastro/voce, curava anche l’aspetto scenico dell’opera.“ Luca Cossettini in: Colloquio con André Richard, S. 247.
39 „Ich denke, dass man angesichts des Fehlens von Anweisungen durch den Autor die Praxis basierend auf Zeitzeugenberichten von Personen angehen muss, die mit ihm an der Klangregie des Stücks gearbeitet haben; auf diese Weise unterbricht man nicht jene hauptsächlich orale Tradition, die sich aus dem Meister-Schüler-Verhältnis ergibt.“ Ebd., S. 242.
40 Henius, Über Luigi Nonos ‚Intolleranza‘ und ‚La fabbrica illuminata‘, S. 128.
41 Ebd., S. 127.
42 Ebd. Henius bezieht sich hier auf Intolleranza 1960.
43 Gleichzeitig lässt sich aus der Ungleichbehandlung von Partitur und Tonband in Hinsicht auf interpretatorische Eingriffe schließen, dass hier ein Verständnis des Tonbands nicht als Text vorliegt.
44 Vgl. Colloquio con André Richard, S. 242.
45 Tatsächlich befindet sich im Archivio Luigi Nono eine Klangregie-Partitur, deren Aufnahme in die Kritische Edition wünschenswert gewesen wäre, wie bereits Nina Jozefowicz schreibt. Vgl. Jozefowicz, Das alltägliche Drama, S. 182.
46 „Die Lösung zu den sich ergebenden Widersprüchlichkeiten muss außerhalb der Texte, in der Aufführungspraxis gesucht werden, die, wie immer, auf einer oralen Tradition im Meister-Schüler-Verhältnis basiert.“ Cossettini, Tracce di un contrappunto a due dimensioni, S. 53. Übersetzung durch die Autorin.
47 „Das wichtigste ist die Mentalität, mit der man herangeht. Das ist ein ethisch-musikwissenschaftliches Problem. Die größte Gefahr besteht darin, ein harmloses, banales, abgeschlossenes Stück zu machen … Wer sich dieser Musik annähern will, muss viel mehr studieren als nur die Noten oder das Band. La Fabbrica lässt sich nicht in eine definierte Ästhetik oder Stilistik einordnen. […] Man muss verstehen, wie und in welchem Kontext das Werk von Nono geschaffen wurde.“ André Richard in: Colloquio con André Richard, S. 247f. Übersetzung durch die Autorin.
48 „Aufgrund des Fehlens von Informationen muss eine musikalische Logik überwiegen, die sich aus dem Band und aus der Partitur ableiten lässt. Die Aufnahmen der Originalaufführungen sind oft eine nützliche Referenz, auch wenn die Aufnahme des elektronischen Teils, besonders, wenn es sich um eine mehrkanalige Ausstrahlung handelt, nicht immer einem objektiven Ergebnis entspricht und daher nicht verabsolutiert werden kann.“ Alvise Vidolin in: Colloquio con Alvise Vidolin su ‚La fabbrica illuminata‘ e ‚Y entoces comprendió‘ (2006), in: Luigi Nono: studi, edizione, testimonianze, S. 251–259, hier S. 252. Übersetzung durch die Autorin.
49 „Ich persönlich halte es für wichtig, dass die musikalische Ausführung den Sinn des Werks zum Ausdruck bringt. Und es gibt nie nur einen einzigen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Unterschiedliche Ausführende können unterschiedliche Strategien einsetzen oder können unterschiedliche Aspekte des Werks herausstellen. Die digitale Elektronik kann diese Arbeit vereinfachen oder Interpretationen ermöglichen, die durch die analoge Technik der Vergangenheit nicht realisierbar waren.“ Ebd., S. 254. Übersetzung durch die Autorin.
50 „Viel hängt von der Sängerin ab, von ihren Aufführungserfahrungen mit Tonband, von ihren Kenntnissen der Nono’schen Ästhetik, von ihrer musikalischen Sensibilität. […] Aus traditioneller Sicht stellt La fabbrica illuminata ein Werk für Duo dar, in dem einer der beiden Interpreten, der Klangregisseur, weniger Freiheiten hat als der andere. Aber es gelten trotzdem die Regeln des Duo-Spiels. Es kann sich auch der umgekehrte Fall ergeben, in dem es der Klangregisseur ist, der weniger Erfahrung im Umgang mit dem Band besitzt, und daher die Sängerin Entscheidungen trifft und dem Klangregisseur die richtigen Anweisungen gibt.“ Ebd., S. 255. Übersetzung durch die Autorin.
51 Ich bin Holger Stenschke (2011–2019 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abt. Forschung & Entwicklung, HSM/FHNW) für die Leitung der Stimmaufnahmen und die Montage zu großem Dank verpflichtet. Basis der Arbeit stellte das als Supplement zur Kritischen Ausgabe mitgelieferte vierspurige Zuspielband dar.
52 In einem sehr frühen Stadium der Entwicklung des vorliegenden Projekts war eine Erneuerung des gesamten Bands in Betracht gezogen worden. Technisch wäre eine solche Re-Interpretation des Tonbands möglich, wobei sich diese zwischen den Extremen „akustische Imitation der ursprünglichen Klänge“ und „dramaturgische Neuinterpretation“ – beispielsweise im Hinblick auf die jeweilige Aktualität und Brisanz der Klänge – bewegen könnte. Letztere entspräche einer aus klangästhetischer Sicht mit dem historischen Band vermutlich kaum noch identifizierbaren Neu-Realisierung. Nicht nur rechtliche Probleme und der enorme Arbeitsaufwand waren für das Verwerfen dieser Umsetzungen verantwortlich. Im vorliegenden Projekt ging es nicht darum, das Zuspielband grundsätzlich als veraltet oder unbenutzbar darzustellen. Vielmehr sollte das Augenmerk auf aufführungspraktische Probleme gerichtet werden, die mit den konzeptionellen Ursprüngen der Komposition (Identität von Live- und Tonbandstimme), Unschärfen in der Erstellung der Aufführungsmaterialien sowie der spezifischen Art der Tradierung aufführungspraktisch relevanter Informationen zusammenhängen. Die ausgewählte Passage ist diesbezüglich besonders aussagekräftig – nicht zuletzt aufgrund der ausschließlich hier identifizierbaren Stimme Carla Henius’ auf dem Band.
53 Eine für das vorliegende Projekt sinnvolle Definition für den Begriff des „Reenactment“ stammt aus dem Kontext der Kunstvermittlung mit Fokus auf die Performance-Kunst. „Beim künstlerischen Reenactment geht es weniger um das Eintauchen in eine historische Situation, wie es beispielsweise bei einem Live-Rollenspiel oder Living History Museum im Vordergrund steht, sondern um das Erleben und Reflektieren fernab der medial repräsentierten Geschichte im Hier und Jetzt. Es geht um Präsenz. Im Vordergrund stehen nicht die Wiederholung eines historischen Ereignisses und damit die Reproduktion von Bildern, es geht vielmehr um Nachvollzug, als das eigene Erleben und berührt sein.“ Katharina Hausman, Reenactment ≠ Reenactment, in: Kunstvermittlung als performative Praxis. In der Ausstellung ‚Moments. Eine Geschichte der Performance in 10 Akten‘, ZKM, Museum für Neue Kunst, S. 37, online verfügbar unter http://zkm.de/media/file/de/moments_kunstvermittlung_online.pdf, zuletzt eingesehen am 13.10.2016.
54 Henius hatte davon berichtet, dass in Räumen mit unterschiedlicher Akustik aufgenommen wurde: „[W]ir haben zahllose Fassungen gemacht, teils in schalltoten, teils in überakustischen Räumen, Materiale aus einzelnen technisch sehr unterschiedlich gesungenen Tönen, Vokale, Worte, teils gesprochen, gesungen, geflüstert – alles dies auch innerhalb der einzelnen Worte noch vermischt.“ Henius, Über Luigi Nonos ‚Intolleranza‘ und ‚La fabbrica illuminata‘, S. 129. In der Materialsammlung finden sich mitunter auch Kommentare von Nono oder Henius zum Gesungenen, die den jeweiligen Hallverhältnissen der gesungenen Passagen entsprechen. Auch daraus lässt sich ableiten, dass das Material hier noch unbearbeitet vorliegt.
55 Vgl. Nono, La fabbrica illuminata, S. 1 und 4.
56 Auf die Korrektur der letzten Chor-Passage am Ende des Bands zum Abnehmen des Anfangstons für das Finale wurde bewusst verzichtet, da die vom ALN gegebene Einwilligung zur Manipulation am Band sich auf den Abschnitt Giro del letto beschränkte.
57 Für eine ausführliche Darstellung dieser Anpassungen s. Krüger, Musik über Stimmen, S. 231ff.
58 Vgl. Paulo de Assis, Con Luigi Nono. Unfolding Waves, in: Journal for Artistic Research 6 (2014), online verfügbar unter: https://jar-online.net/en/exposition/abstract/con-luigi-nono-unfolding-waves, zuletzt eingesehen am 10.08.2019.
59 Ob sich der Begriff der Zukunft hier wirklich anwenden lässt, sei dahingestellt. De Assis verbindet mit den metastrata „new materials generated at every future historical time“. Diese Materialien werden jedoch erst mit ihrer tatsächlichen Vergegenwärtigung greifbar. Insofern ließe sich hier fragen, ob es sich bei dem von de Assis genannten Horizont der Zukunft nicht eher um eine erweiterte Gegenwart handelt. Vgl. Paulo de Assis, Logic of Experimentation. Rethinking Music Performance through Artistic Research, Leuven 2018, S. 65.
60 De Assis, Logic of Experimentation, S. 100.
61 Ebd., S. 30f.
62 Henius, Über Luigi Nonos ‚Intolleranza‘ und ‚La fabbrica illuminata‘, S. 129.
63 Vgl. Martin Tröndle, Methods of Artistic Research. Kunstforschung im Spiegel künstlerischer Arbeitsprozesse, in: Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft. Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und Kunst, hrsg. von Martin Tröndle und Julia Warmers, Bielefeld 2014, S. 169–198, hier S. 183f., sowie Krüger, Musik über Stimmen, S. 239 und S. 501f.
64 „[N]either the internal nor the external aspects [of human cognition] are sufficient in themselves to contain the operations of the human mind. Thinking is not something that happens ‚inside‘ brains, bodies, or things; rather, it emerges from contextualized processes that take place ‚between‘ brains, bodies, and things. […] The new approach involves a change of analytic unit and a shift in the level of description from the micro level of semantics to the macro level of practice.“ Lambros Malafouris, How Things Shape the Mind. A Theory of Material Engagement, Cambridge 2013, S. 77–79.
65 Vgl. Uriel Orlow, Recherchieren, in: Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, hrsg. von Jens Badura et al., Zürich 2015, S. 201–204, hier S. 201.
66 Im Rahmen einer öffentlichen Lehrveranstaltung der Hochschule für Musik Basel (Colloquium 48) fand am 28.10.2016 die kommentierte Aufführung von La fabbrica illuminata (integral mit historischem Zuspielband) sowie der Passage Giro del letto mit dem modifizierten Zuspielband statt. Die anschließende Diskussion mit dem Publikum entspricht selbstverständlich keiner repräsentativen Erhebung, ließ jedoch Tendenzen der Wahrnehmung hervortreten.
67 Henius, Arbeitsnotizen, August 1964, S. 38. Zur Frage der Theatralität von La fabbrica illuminata s. auch Lehmann, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater, S. 197–230, insb. S. 216ff.
68 Karlheinz Stockhausen hatte in Aufführungen von Kompositionen wie Telemusik (1966) oder Kontakte (1958–1960) Projektionen eingesetzt, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu fokussieren. Irene Lehmann versteht La fabbrica illuminata auch als bewusste Überschreitung der Konventionen des Konzertwesens, indem Sichtbares und Hörbares nicht mehr kongruent sind. Vgl. Lehmann, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater, S. 202.
69 „Es ist wie ein großer Schauspielmonolog, eine ‚Szene‘ eher als ein Konzertstück.“ Henius, Arbeitsnotizen, August 1964, S. 35.
70 Irene Lehmann versteht die Figur der Sängerin in der Fabbrica grundsätzlich als Verkörperung einer Arbeiterin, deren Nicht-Integrität jedoch durch die Überlappung von Live-Stimme und Tonband, insbesondere aber von solistischer Live- und Bandstimme, bezeugt wird. „Zur Etablierung des Risses nimmt die Verwendung des Tonbandes eine bedeutende Funktion ein, bei der die Sängerin mit ihrer eigenen Stimme interagiert.“ Lehmann, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater, S. 227. Dabei berücksichtigt Lehmann jedoch nicht, dass dieses Interagieren mit der eigenen Stimme seit Henius nicht mehr praktiziert werden kann und dass die Wahrnehmung der Konstellation Interpretin – Zuspielband davon erheblich beeinflusst wird.
71 Flammer, Politisch engagierte Musik als kompositorisches Problem, S. 84 und 92. Vgl. dazu auch Lehmann, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater, S. 220ff. Lehmann vertritt hier eine Sicht auf die solistische Frauenstimme nicht vor dem Hintergrund der üblichen Dichotomien Mensch und Maschine, Natur und Kultur, Geist und Körper, sondern vielmehr als Akteurin in ihrer speziellen Situation als Frau bzw. Arbeiterin. Dabei steht die solistische Stimme der im Zuspielband präsenten Fabrik nicht zwangsläufig antagonistisch gegenüber. Vgl. ebd., S. 226.
72 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M. 2004, S. 219.
73 Vgl. Lehmann, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater, S. 227.
74 Die Sopranistin Sarah Sun wählt eine Lichtregie mit zum Teil diffusem Licht bzw. starker Abdunkelung des Bühnenraums, wodurch die Person der Live-Interpretin nur wenig Fokus erhält. So geschehen bei einem Konzert im Rahmen der Konzertreihe Dialog, Gare du Nord Basel, 08.12.2014. Auch die Autorin dimmt in den Aufführungen während der längeren rein elektroakustischen Passagen das Licht.
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Stimme und Person in der Philosophischen Anthropologie.
- 2. Gesangstechniken in der zeitgenössischen Vokalmusik
- 3. Sologesang des 20. und 21. Jahrhunderts
- 4. „The Alienation of the Singer from Her Gattungswesen“
- 5. Stimme im 21. Jahrhundert
- 7. Die Schönheit des Dazwischen in Vokalmusik
- 8. Den eigenen kulturellen Hintergrund überdenken
- 9. Die eigene Stimme finden
- Kurzbiografien
- Bildnachweis